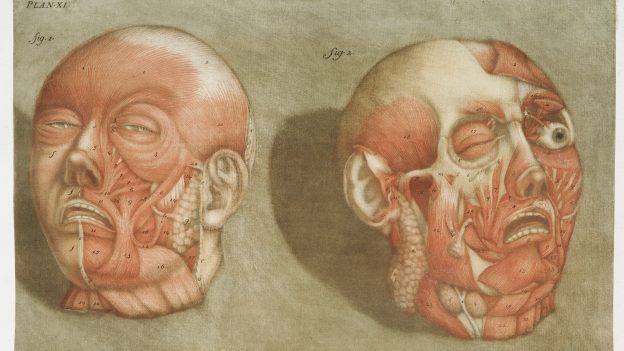Erinnerungen an einen Kurzurlaub im Krisengebiet.
Erinnerungen an einen Kurzurlaub im Krisengebiet.
Die Stille detoniert mit der Wucht eines Marschflugkörpers. Fünf dunkle Augenpaare starren mich an, beobachten, wie ich vorsichtig mein Bier auf den Tisch zurückstelle. Mit eiskalter Ernüchterung begreife ich, ich habe irgendetwas schrecklich Falsches getan. Ich habe nur keinen blassen Schimmer was?
Das Schweigen der Runde dröhnt in meinen Ohren, übertönt die übrigen Gespräche im Lokal. Wir sitzen im Emona 2000, einem netten kleinen Club im Kosovo – es war ein Abend unter Albanern. Was hätte schon schiefgehen können?
Scheiße, fluche ich stumm, wo sind meine verdammten Freunde von der KFOR?
Ein Tag zuvor:
Die Transall startet. Final Destination: Kosovo, Krisengebiet. Laut und holprig pflügt sich die schwere Militärmaschine wie ein Traktor Richtung Wolken. In ihrem Bauch hocken auf ausgeklappten Leinenbänken Soldaten. Dicht gedrängt in engen Reihen. Die Jungs schweigen, manche lesen oder hören Musik. Zum Scherzen ist kaum einer aufgelegt – nicht einmal zu Blickkontakten.
Ich bin der einzige Zivilist im Flieger Richtung Pristina, der Hauptstadt des Kosovo. Ich bin übermüdet und kann doch vor Kälte nicht schlafen. In meinen Ohren stecken gelbe Schaumstoff-Pfropfen gegen den Propellerlärm, an meinem Oberkörper flattert ein dünnes T-Shirt. Knapp drei Stunden Ruhe – mehr war die Nacht nicht drin. Frühmorgens kam ich am Fliegerhorst beim bayerischen Landsberg an. Die Sonne schien bereits, und das T-Shirt reichte, um nicht zu frieren. Keiner der Jungs in den gefütterten Camouflage-Anzügen hielt es für nötig, dem Reporter zu verklickern, dass der Flug in einer Transall kein Vergnügungstrip ist. Die Wände sind mit dünnen Druckknopfdecken isoliert. Eine Heizung? Gibt es nicht. Im Krieg ist nur das Nötigste gefragt. Netterweise hielten mir die Kameraden einen Platz hinten an der Luke frei.
Nirgends in den bauchigen Transportmaschinen ist es kälter. Mit klappernden Zähnen schimpfe ich still in mich hinein.
 Kontakt zum Militär gab es in meinem Leben nie – im Gegenteil. Meine erste Liebe schickte mir oft Briefe, obwohl wir damals nur ein paar Häuser voneinander entfernt wohnten. Einmal hatte sie eine kleine Schildkröte auf den Umschlag gezeichnet. Die Comic-Kröte penetrierte einen Stahlhelm. Darunter stand in bunten Buchstaben: „Fuck the Army“. Sie hielt den Sponti-Humor für cool. Wir waren ein verlaustes Dreadlock-Pärchen voller Ideale und Pathos, das sich in die falsche Zeit geboren fühlte. Jetzt, fast zehn Jahre später, ich bin 25, haben sich die Zeiten geändert. Das Hippie-Leben ist vorbei, konstatiere ich bibbernd in der Transall. The Army fucks you. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer – und ich werde ihm in den kommenden Tagen die Wahrheiten meiner Jugend opfern. Ich bin Journalist für eine süddeutsche Tageszeitung und besuche unsere Truppen an der serbischen Grenze.
Kontakt zum Militär gab es in meinem Leben nie – im Gegenteil. Meine erste Liebe schickte mir oft Briefe, obwohl wir damals nur ein paar Häuser voneinander entfernt wohnten. Einmal hatte sie eine kleine Schildkröte auf den Umschlag gezeichnet. Die Comic-Kröte penetrierte einen Stahlhelm. Darunter stand in bunten Buchstaben: „Fuck the Army“. Sie hielt den Sponti-Humor für cool. Wir waren ein verlaustes Dreadlock-Pärchen voller Ideale und Pathos, das sich in die falsche Zeit geboren fühlte. Jetzt, fast zehn Jahre später, ich bin 25, haben sich die Zeiten geändert. Das Hippie-Leben ist vorbei, konstatiere ich bibbernd in der Transall. The Army fucks you. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer – und ich werde ihm in den kommenden Tagen die Wahrheiten meiner Jugend opfern. Ich bin Journalist für eine süddeutsche Tageszeitung und besuche unsere Truppen an der serbischen Grenze.
Fünfzig Mann zwischen 20 und 50 Jahren fliegen ihrem viermonatigen Einsatz entgegen. Fünfzig Soldaten im Kampfanzug und ich in einem grauen Shirt, einer verwaschenen Jeans mit Designer-Löchern und weißen Samba-Sneakern gemeinsam gen Sonne. Der Reporter soll in Krisengebieten weder Waffen noch Uniform tragen – ein ungeschriebenes Gesetz unter Journalisten. Erschwert die Eingliederung in die Truppe, erleichtert eine objektive Berichterstattung. Na ja, vor Verbrüderungseffekten fürchte ich mich weniger als vor fehlender Objektivität. Der Sechzehnjährige mit den Dreads giftet während des Fluges unentwegt in meiner Brust.
Zweieinhalb Stunden und knapp 800 Meilen später stehe ich am Flughafen der Hauptstadt Pristina. Ein Typ mit orangefarbener Ordnerjacke über seinem Tarndress winkt mich direkt aus der Reihe. Es ist der Beginn von drei Tagen akribisch kontrollierter Berichterstattung.
 Für meinen Crashkurs in Sachen Bundeswehr bekomme ich Oberstleutnant Jens Darius Müller* zur Seite gestellt. Er und Fräulein Pichler* (Ihren Vornamen habe ich nie erfahren) sind meine Presseoffiziere. Müller, 28, verschmitztes Gesicht, Segelohren. Pichler, Österreicherin, Anfang zwanzig, blond, große Schneidezähne, nettes Lächeln. Pichler steht rangmäßig unter Müller. Sie holt Cola für alle, während er mit mir vor der Abflughalle wartet und raucht. So etwas nennt man wohl „länderübergreifende PR-Arbeit“. Sowohl Deutsche als auch Österreichische Soldaten arbeiten im Public Information Office (kurz PIO) des Hauptlagers der Multinational Task Force Süd in Prizren, der mit knapp 180.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Kosovo. Pichler und Müller werden mich die nächsten Tage von morgens acht bis abends acht begleiten. Die Zwei haben mein Alter. Das macht das Händchenhalten angenehmer.
Für meinen Crashkurs in Sachen Bundeswehr bekomme ich Oberstleutnant Jens Darius Müller* zur Seite gestellt. Er und Fräulein Pichler* (Ihren Vornamen habe ich nie erfahren) sind meine Presseoffiziere. Müller, 28, verschmitztes Gesicht, Segelohren. Pichler, Österreicherin, Anfang zwanzig, blond, große Schneidezähne, nettes Lächeln. Pichler steht rangmäßig unter Müller. Sie holt Cola für alle, während er mit mir vor der Abflughalle wartet und raucht. So etwas nennt man wohl „länderübergreifende PR-Arbeit“. Sowohl Deutsche als auch Österreichische Soldaten arbeiten im Public Information Office (kurz PIO) des Hauptlagers der Multinational Task Force Süd in Prizren, der mit knapp 180.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt des Kosovo. Pichler und Müller werden mich die nächsten Tage von morgens acht bis abends acht begleiten. Die Zwei haben mein Alter. Das macht das Händchenhalten angenehmer.
Mein Auftrag im Krisengebiet ist nicht spektakulär: Für die Sigmaringer Lokalausgabe besuche ich das Fernmeldebataillon. Das heißt ein paar Interviews, eine Reportage, ein oder zwei Porträts. 190 Soldaten aus der schwäbischen Kreisstadt sind derzeit in Prizren stationiert. Die Leser sollen erfahren, wie es unseren Jungs und Mädels ergeht.
Wir sitzen in einem silbernen Nissan-Jeep mit großem KFOR-Aufkleber und Klimaanlage und arbeiten uns entlang der Duck-Route Richtung Prizren. Wie die Lion’s oder Hawk-Route haben im Kosovo alle größeren Straßen von den Amerikanern Tiernamen bekommen. Irritiert frage ich nach, aber Müller kann mir nicht erklären, warum gerade der Entenpfad zu den Deutschen führt.
Immer wieder legen wir kurze Stopps ein, damit ich Fotos schießen kann. Vor mir in der Lehne stecken Wasserflaschen, still und kohlensäurehaltig. Und rechts auf dem Sitz liegt eine Plastiktüte mit Kuchenteilchen. Hätte ich nicht so viele Haftungsausschlüsse unterschreiben müssen, ich würde mich sicher fühlen. 90 Minuten dauert die Fahrt über holprige und steinige Wege vom Flughafen zum Lager.
 „Das hier könnte sicherlich interessant für Sie sein.“ Der Jeep stoppt. Müller öffnet die Fahrertür, und ein Schwall heiß-trockener Luft schlägt ins Wageninnere. Der Mann setzt seine Mütze auf, steigt aus und zeigt auf einen Grabstein am Straßenrand.
„Das hier könnte sicherlich interessant für Sie sein.“ Der Jeep stoppt. Müller öffnet die Fahrertür, und ein Schwall heiß-trockener Luft schlägt ins Wageninnere. Der Mann setzt seine Mütze auf, steigt aus und zeigt auf einen Grabstein am Straßenrand.
Bei jedem Halt auf unserer Tour dasselbe Spielchen: Der Oberstleutnant und Fräulein Pichler verlassen den klimatisierten Nissan, das Haupt wird bedeckt, zurück im Kühlen entblößt. Müller meint nur: „Das gehört sich halt so.“ Und ich höre den sechzehnjährigen Klugscheißer mit den Dreadlocks im Hinterkopf ätzen: „Ja, klar! Verinnerlichte Regelkonformität bei 45 Grad im Schatten, Mann. Fuck the Army!“
Ja, und die Army schießt prompt zurück – nur etwas subtiler. Wir stehen am Gedenkstein der Stern-Reporter Volker Krämer und Gabriel Grüner, die 1999 nahe der Ortschaft Dulje von einem russischen Söldner erschossen wurden, als er nach Kriegsende vor der KFOR floh. Müller und ich stecken uns Kippen an. Die Message der Station klingt für mich deutlich durch: Hör auf die Bundeswehr, sonst endet es böse. Auf der schwarzen Steinplatte finden sich etliche Rechtschreibfehler und ein Zitat des großen deutschen Schriftstellers „Bert Breht“. Müller meint dazu nur, der Albaner hat es nicht so mit dem „ch“.
Punkt.
Die Zigarettenstummel in den Staub, Mützen ab, wir fahren weiter.
Das Kosovo entlang der Duck-Route ist verdreckt. Die Landschaft gleicht einem Bild, das mit Gewalt aus einem halben Dutzend Puzzlespielen zusammengesteckt wurde. Karge Hügel sind gespickt mit PET-Halden, Auto-Friedhöfen und Binden-Depots. Neben Ruinen reihen sich Einfamilienhäuser aus rotem Backstein, an manchen Ecken ragen stylische Neubauten in den Himmel. Bautrupps ziehen ein großes Einkaufszentrum mit Glasfassade und der Aufschrift Big Brother hoch, während die Menschen auf den Viehmärkten nebenan um Kühe und Ziegen feilschen.
 Am 10. September 2012 hat das Kosovo offiziell seine volle Souveränität erhalten, vier Jahre zuvor erklärte es seine Unabhängigkeit, doch jetzt ist es erst 2007. Rund sechs Millionen Minen sind im kosovarischen Boden vergraben. Das Kosovo ist noch in fünf Task Force-Gebiete unterteilt: North, South, East, West und Central. Jeweils unter verschiedenen Führungsnationen. Über tausend der insgesamt 3700 Soldaten aus den sieben Nationen der Multinational Task Force Süd sind im Hauptlager Prizren stationiert. Die übrigen leben in Camps der Großgemeinden Dulje und Dragas. Die Soldaten haben Aufenthaltsräume, kleine Bars, Fitness-Zelte und einen Sportplatz. Auf den Zimmern stehen DVD-Player, an den Wänden hängen die obligatorischen Wichs-Kalender. Titten und TV. Alles wie Zuhause – nur hier mit Nato-Zaun und Waffengewalt gesichert.
Am 10. September 2012 hat das Kosovo offiziell seine volle Souveränität erhalten, vier Jahre zuvor erklärte es seine Unabhängigkeit, doch jetzt ist es erst 2007. Rund sechs Millionen Minen sind im kosovarischen Boden vergraben. Das Kosovo ist noch in fünf Task Force-Gebiete unterteilt: North, South, East, West und Central. Jeweils unter verschiedenen Führungsnationen. Über tausend der insgesamt 3700 Soldaten aus den sieben Nationen der Multinational Task Force Süd sind im Hauptlager Prizren stationiert. Die übrigen leben in Camps der Großgemeinden Dulje und Dragas. Die Soldaten haben Aufenthaltsräume, kleine Bars, Fitness-Zelte und einen Sportplatz. Auf den Zimmern stehen DVD-Player, an den Wänden hängen die obligatorischen Wichs-Kalender. Titten und TV. Alles wie Zuhause – nur hier mit Nato-Zaun und Waffengewalt gesichert.
Nach einem kurzen Briefing zum Ablauf der kommenden Tage treffe ich im Hauptquartier auf die Führungsriege der Fernmelder. Vier Tische sind in einem weißgestrichenen Konferenzraum zur U-Form geschoben, Namensschilder und Flaschen mit Sprudel und Orangensaft stehen bereit. Vor Kopf hängt eine große Beamerleinwand. Oberstleutnant Björn Sträter*, Kommandeur des Sigmaringer Fernmeldebataillons, und zwei Kompaniechefs begrüßen mich. Ihre Gesichtszüge zucken widerwillig, als wir uns die Hände reichen. Der Grund soll sich mir erst später erschließen. Der Sechzehnjährige übernimmt plötzlich die Oberhand und sucht sich betont lässig einen Platz. Ich höre, wie er beiläufig erwähnt, dass unser Namensschild falsch geschrieben ist: „Bastian nicht Se-bastian Schlange“, sagt er, und ich sehe ihn eine Wasserflasche mit unserem Che-Guevara-Einwegfeuerzeug öffnen. Pfff, subtiler Protest lag uns noch nie.
Der Beamer flackert auf: „Das Sigmaringer Fernmeldebataillon begrüßt Herrn Schlange von der Schwäbischen Zeitung.“ Als die erste von drei Dutzend Folien auf der Leinwand erscheint, beginne ich die verhaltenen Mienen der Offiziere zu verstehen. Drei gestandene Soldaten jenseits der vierzig haben die vergangenen Tage damit verbracht, eine Präsentation für … ja, für mich zu erstellen. Daten, Fakten, grafische Elemente. Powerpoint und Photoshop. Drei Tage verschissen für einen Jungspund mit Vollbart, der offensichtlich null Schimmer vom Militär hat, wuscheliges Haar, tätowierte Arme und nicht mal den Anstand besitzt, vernünftige Schuhe anzuziehen. Da dürfen dem waschechten Soldaten schon einmal die Mundwinkeln zucken.
Ähnliche Sympathien, als ich im Anschluss Brigadegeneral Werner Pfeiffer* besuche, oberster Kommandeur der Multinational Task Force Süd. Wäre Pfeiffer jünger und würde zu seinem flaumigen Oberlippenbart Metall-Matte statt Halbglatze tragen, ich würde ihn in einem Jugendzimmer sitzen sehen, die Wände mit Iron Maiden- und Metallica-Postern tapeziert und sehnlichst auf das nächste Schützenfest wartend. Hier, im Kosovo, ist er verantwortlich für tausende von Menschenleben. Das Interview mit ihm soll nicht für den Pulitzer reichen. Die zentrale Aussage: „Die Lage ist ruhig, aber nicht stabil.“
 In den kommenden Tagen dasselbe Spielchen: Ich produziere journalistische Scheiße, bekomme der Reihe nach blutleere Phrasen als große Wahrheiten aufgetischt. Den Satz „Die Lage ist ruhig, aber nicht stabil“ werde ich noch von sieben Soldaten mit den unterschiedlichsten Rängen hören – Feldwebeln, Oberstleutnants, Generälen. Müller meint nur: „Der Satz trifft die Situation.“ Der Sechzehnjährige denkt: „Ey, Alter, wer den Swing in sich hat, kann nicht im Gleichschritt marschieren. Basta!“ Und beide Seiten bleiben ihren Zwängen verhaftet.
In den kommenden Tagen dasselbe Spielchen: Ich produziere journalistische Scheiße, bekomme der Reihe nach blutleere Phrasen als große Wahrheiten aufgetischt. Den Satz „Die Lage ist ruhig, aber nicht stabil“ werde ich noch von sieben Soldaten mit den unterschiedlichsten Rängen hören – Feldwebeln, Oberstleutnants, Generälen. Müller meint nur: „Der Satz trifft die Situation.“ Der Sechzehnjährige denkt: „Ey, Alter, wer den Swing in sich hat, kann nicht im Gleichschritt marschieren. Basta!“ Und beide Seiten bleiben ihren Zwängen verhaftet.
Das System der Bundeswehr basiert auf Kontrolle. Klare Hierarchien, klare Regeln, klares Leben. Der Untergebene grüßt den Vorgesetzten. Für jede Situation gibt es vorgeschriebene Verhaltensweisen. Regelneurosen hinter jedem Fuchs-Panzer. Ein klarer Stundenplan diktiert meine kommenden Tage. Jedes Treffen ist organisiert. Müller achtet darauf, welche Informationen ich bekomme und wie die Story inszeniert wird. Kontrollierte PR-Arbeit im olivgrünen Disneyland – Hubschrauber-Rundflüge, Kletterpartien und Zuckerwatte inklusive. Die einzige Chance, interessante Geschichten zu finden, ist, jene zu entdecken, die das Militär übersieht. Die kleinen Details zu sammeln, die durch die Kontrolle fallen, weil Müller nicht mal begreift, dass sie existieren. Es ist wie eine Pokerpartie am runden Tisch des Krisenherdes. Müller versucht seine Sache zu verkaufen, ich das Beste daraus zu machen. Uns bleiben noch zwei Tage.
Meine erste Nacht im Hotel „Mena“:
 Die KFOR bringt mich – aus versicherungstechnischen Gründen – in einem Hotel in Prizren unter. Anfangs erscheint es als gute Idee. Soldatenbetten messen 0,80 m mal 1,90 m. Hier habe ich ein großes Zimmer mit Doppelbett und Fernseher. Braune Plüschpantoffeln mit aufgestickten Tulpen-Umrissen stehen am Fußende, vor den Fenstern hängen Spitzengardinen. Ein wenig Dreck in den Ecken und Fugen hat mich noch nie gestört.
Die KFOR bringt mich – aus versicherungstechnischen Gründen – in einem Hotel in Prizren unter. Anfangs erscheint es als gute Idee. Soldatenbetten messen 0,80 m mal 1,90 m. Hier habe ich ein großes Zimmer mit Doppelbett und Fernseher. Braune Plüschpantoffeln mit aufgestickten Tulpen-Umrissen stehen am Fußende, vor den Fenstern hängen Spitzengardinen. Ein wenig Dreck in den Ecken und Fugen hat mich noch nie gestört.
Der Schock kommt trotzdem. Im Bad. Unter dem Rand der Kloschüssel blinzelt mich herausfordernd eine kleine, silberne Düse an. Bei Knopfdruck sprudelt aus dem Metall-Röhrchen kaltes Wasser. Meine Fantasie beginnt zu arbeiteten, ich schlucke, der Morgen erfüllt sich mit Schrecken: Kosovaren kennen kein Klopapier. Mir kurz nach Sonnenaufgang mit der linken Hand die Kimme zu wischen, kommt nicht in Frage. Die drei bekackten Muscheln für den Demolition Man liegen nirgends aus. Ich resigniere, beschließe, meine Backen zusammenzukneifen und bei nächster Gelegenheit Klopapier aus der Kaserne zu klauen. Mein Sechzehnjährige feiert mich, sich und die Rebellion im Hinterkopf.
Nachdem meine Klamotten verstaut sind, wechsle ich zur Hotel-Bar in den Keller und transkribiere die Interviews. Peja, das kosovarische Bier, schmeckt lausig, ist aber günstig. Ich vermerke: Für den ersten Tag kann Müller einen Punktsieg verbuchen.
Als wir am Nachmittag den Kasernenhof überquerten, blieb er plötzlich stehen. „Das sollten Sie unbedingt fotografieren. Ein außergewöhnliches Bild.“ Er zeigte auf die Fahnenmäste der KFOR-Nationen. „Es kommt hier wirklich selten vor, dass alle Fahnen so voll im Wind stehen.“ Ich war ein braver Journalist und drückte ab. Neun aufrechte, stolze Fahnen – ein heldenhaftes Bild. In den kommenden Tagen werde ich bei jedem Kasernengang immer wieder Zeuge desselben „seltenen“ und wirklich „außergewöhnlichen“ Anblicks werden. Die Scheiß-Fahnen flattern hier ständig im Wind. Aber das Bild war im Kasten, es würde in der Redaktion landen. Müller hatte mich gefickt. Meine Hand schnellt zum Peja – morgen ist auch noch ein Tag – ich trinke und habe an der Bar meine erste Begegnung mit Agron, einem der Hotelmitarbeiter. Agron ist Albaner, der Typ Player. Ende zwanzig, schwarze Haare bis zu den Ohren, streng zurückgegelt, einnehmendes Grinsen, vier verfaulte Zähne im Mund. Er wird mein Ticket zur Halbwelt Prizrens.
 Die Sicht ins Bistrica-Tal ist überwältigend. Unter den blauen Bögen des Horizonts erstrecken sich endlose Hügellandschaften – frei von Spuren des modernen Lebens. Kleine Büsche, graue Felsen, alte Ruinen. Eidechsen flüchten vor mir und Müllers Springerstiefeln in den Schutz der Vegetation. Wir stehen am Erzengel-Kloster. Dem ersten von sieben Programmpunkten des Tages. Es ist kurz nach neun.
Die Sicht ins Bistrica-Tal ist überwältigend. Unter den blauen Bögen des Horizonts erstrecken sich endlose Hügellandschaften – frei von Spuren des modernen Lebens. Kleine Büsche, graue Felsen, alte Ruinen. Eidechsen flüchten vor mir und Müllers Springerstiefeln in den Schutz der Vegetation. Wir stehen am Erzengel-Kloster. Dem ersten von sieben Programmpunkten des Tages. Es ist kurz nach neun.
Im März 2004 stürmte ein aufgebrachter Mob von knapp dreihundert Albanern das serbisch-orthodoxe Kloster und brannte es bis auf die Mauern nieder – als Symbol ihrer Unterdrückung. Die acht Mönche, die dort lebten, konnten damals nur knapp entkommen. Jetzt kontrollieren KFOR-Truppen jeden, der den heiligen Boden betreten möchte. Tapfere Jungs in Camouflage. Ihre Antworten kommen wie aus der Retorte geschossen: „Die Lage ist ruhig, aber nicht stabil.“ Mein linkes Augenlid beginnt zu zucken. Die Wahrheit marschiert hier im Gleichschritt. Verdammt. Ich brauche Kontakt zu echten Menschen. Wenn das heute mit den Waffenträgern nichts wird, suche ich in der Abenddämmerung mein Glück bei den Albanern. Fuck the Army.
Nach dem Mittagessen im Camp Prizren und einer Herz-Schmerz-Reportage über Vater und Sohn, die beide im Lager stationiert sind, geht es zum nächsten Programmpunkt: ein Heli-Flug zu einer Relaisstation der Fernmelder knapp zwei Kilometer vor der serbischen Grenze. Müller strahlt schon seit Stunden wie ein kleiner Junge, der zwei Freikarten für den Achtfach-Looping der Texas-Tornado-Bahn gewonnen hat. Die Truppen investieren richtig Kohle für ihre PR-Arbeit – und mich ungepflegten Asi. Ich verschiebe meinen Klopapier-Klau auf nach den Flug.
Der Sicherheit wegen kommunizieren die KFOR-Truppen über eigene Funknetze. Im bergigen Kosovo sind die Einheiten auf mobile Relaisstationen angewiesen, die das Funknetz erweitern. Die Fernmelder „garantieren die Führungsfähigkeit unserer gesamten Truppe“, um Pfeiffer und drei Dutzend offizieller Broschüren im selben Wortlaut zu zitieren. Kommunikation ist die Grundlage jeder Gemeinschaft.
Kommunikation zeichnet Wirklichkeit. Sie transportiert Informationen und schafft mit ihnen Wahrheiten. Mittlerweile existieren etliche Kanäle, aus denen die Informationsflut schießt. Dem Menschen reicht es nicht mehr, nur seine direkte Umgebung wahrzunehmen. Er ist süchtig geworden nach der unergründlicher Scheiße vom gesamten Globus. Kommunikation öffnet ihm die Abflussrohre zur Welt. In den klassischen Medien kontrollieren Gatekeeper was letztendlich durchkommt oder nicht. Journalisten, die Schleusenwärter. Berichten sie dir nicht von Kriegen, gibt es keine. Schlachten sie ein Thema aus, ist deine Realität voll Sodomie, Kindesmissbrauch und Drogenexzesse. Wer sind die Gatekeeper der Bundeswehr?
 Milchige Nebelschwaden haben sich über das Land gelegt.
Milchige Nebelschwaden haben sich über das Land gelegt.
„Wir haben richtig Glück.“ Müller grinst. „Wir werden die Strecke im Konturenflug zurücklegen.“
Ich schaue ihn fragend an.
„Haben Sie Flugangst?“
„Denke nicht.“
Der Heli hebt ab. Konturenflug ist fun. Der Hubschrauber fliegt niedrig, folgt jeder Unebenheit des Terrains, um nicht vom feindlichen Radar erfasst zu werden. Im Kosovo besser als Achterbahn. Wir sitzen in einer Bell UH-1D, einem mittleren Transporthubschrauber: Höchstgeschwindigkeit 220 km/h, 500 Kilometer Reichweite, 1044 kW Leistung. Seit 65 offiziell im Einsatz der Bundeswehr. Während unseres Fluges kriegt Müller kaum das Grinsen aus dem Gesicht. Und Scheiße, mir ergeht es ähnlich.
 Dann die Ankunft. Der schwere Dunst des Lagerkollers lastet auf dem Camp der Fernmelder. Gut zehn Mann sind dort zusammengepfercht – auf einer 40 mal 100 Meter großen Fläche mitten in der Pampa. 50 Tonnen Sand in Säcken drumherum gescharrt und kilometerweise Natozaun verlegt. Ein Fuchs-Panzer steht in Stellung, und einige Jungs mit ihren G36, dem Standardsturmgewehr beim Bund – 750 Schuss pro Minute – sind jederzeit bereit auf Kakerlaken zu feuern. Sonst nichts. Soweit das Auge reicht.
Dann die Ankunft. Der schwere Dunst des Lagerkollers lastet auf dem Camp der Fernmelder. Gut zehn Mann sind dort zusammengepfercht – auf einer 40 mal 100 Meter großen Fläche mitten in der Pampa. 50 Tonnen Sand in Säcken drumherum gescharrt und kilometerweise Natozaun verlegt. Ein Fuchs-Panzer steht in Stellung, und einige Jungs mit ihren G36, dem Standardsturmgewehr beim Bund – 750 Schuss pro Minute – sind jederzeit bereit auf Kakerlaken zu feuern. Sonst nichts. Soweit das Auge reicht.
Die Fernmelder halten das Gerüst, auf dem ihre Wirklichkeit steht. Es ist das Gleichnis des modernen Atlas im Khakihemd, der irgendwo nahe der serbischen Grenze die olivgrüne Welt auf seinen Schultern stemmt. Zum Gatekeeper-Regime gehören andere.
(Müller strich mir in der offiziellen Reportage folgende Formulierung an: „Alle 24 Stunden werden die Burschen von einer zweiten Truppe abgelöst. 24 Stunden Einöde und zurück. Immer im Wechsel.“ Es sollte seiner Meinung nach besser heißen: „in unregelmäßigen Abständen“. Das Wort „unregelmäßig“ versuchte er mir noch an zwei weiteren Stellen aufzudrücken.
Heh, wenn ich eins gelernt habe, dann, dass nichts in diesem Verein „un-regel-mäßig“ geschieht.)
Es folgen weitere Programmpunkte: eine feierliche Parade der Fernmelder (über 400 Mann) auf dem lagerinternen Sportplatz von Prizren, ein Lagerrundgang mit außerplanmäßiger Kletterpartie auf einen dreißig Meter hohen Funkturm, ein Interview mit der Militärpfarrerin zwecks Porträt und schließlich ein Abendessen mit Müller, Pichler, dem Fernmeldechef Sträter und zwei Kompaniechefs zwecks gegenseitiger Akzeptanz. Ich sehne mich nach Bier. Die Soldaten wollen keins mit mir trinken – soviel zur Akzeptanz. Ich sehne mich nach Bier – popeligem Bier – und vor den Uniformierten stehen drei Humpen mit gelb-rot-schlierigem KiBa-Scheiß. Völliger Irrsinn. Und vom Nachtleben in Prizren wird mir eindringlich abgeraten, sollte ich meiden. Stichwort: kulturelle Missverständnisse. Ich atme durch. Der Sechzehnjährige schreit: „Zu den Waffen, Genossen! Das Militär will uns hier systematisch klein und der Wahrheit fernhalten! Bier für das Proletariat!“
Realsatire. Alles. Gestern Nachmittag machten wir einen kurzen Abstecher in die Redaktion der Lagerzeitung. Auf den Tischen stapelten sich etliche Ausgaben der Monatszeitschrift des Reservistenverbandes, dem Magazin für Sicherheitspolitik der Bundeswehr. Der Titel: „Loyal“. BÄM. Tätowiert es euch doch auf die Stirn, ihr Irren!
Diese KFOR- Käfighaltung kotzt mich an. Der Schlange ist ruhig, aber nicht stabil. Ich verschwinde zur Toilette und mache mich von dort mit einer Rolle Klopapier in der Tasche auf direkten Weg zum Badezimmer des Hotels – Informationen verdauen. (Anmerkung zum Toilettenpapier: Soldaten haben einen Anus aus Edelstahl.)
Ein Abend unter Albanern:
Dampf ablassen. Wein, Weib und Freiheit. Scheiß auf kulturelle Missverständnisse und militärische Sicherheiten. In der Hotelbar spreche ich Besi an, um zu erfahren, wo in Prizren was geht. Besi ist Anfang zwanzig und der einzige, der im Hotel etwas Deutsch spricht. Sein Vorschlag für die Dunkelheit: ein Club, Frauen, Live-Musik. Agron, der Kollege vom Vorabend, könne mich in der Bar eines Freundes absetzen, nach der Schicht im Mena stoßen die zwei dazu, und wir ziehen weiter. Ich schaue Besi einen Moment lang an, Szenarien spulen mir durch den Kopf, dann grinse ich und nicke. Ein Deal unter Fremden. Die Nacht kann beginnen.
Ein Berg von Mann, Anfang sechzig, mit einer füllfedergestochenen Moschee auf dem einen und einem 50er Jahre Pin-Up auf dem anderen Unterarm sitzt neben mir am Tresen und trinkt. Das Cafe ist voller Kosovo-Albaner. Drei Business-Typen nippen Rotwein, eine aufgetakelte Perle mit gesprengtem Verfallsdatum schiebt sich an mir vorbei, um Raki zu bestellen. Ich trinke Peja und versuche ein paar brüchige Sätze mit Driti zu wechseln, dem Bartender und Besi-Freund. Ein Junge mit Polaroid-Kamera schießt Fotos für vier Euro, eine Gruppe Jugendlicher sitzt in der Ecke und schaut fern. Liverpool putzt gerade Chelsea vom Rasen. Ich blicke zum Fernseher und hoffe auf die Nacht, die noch kommen soll.
Normalerweise mag ich keine Läden, in denen die Flimmerkiste läuft. Aber hier ist es okay: Obwohl wir einander nicht verstehen, haben Driti und ich das Gefühl, etwas Gemeinsames zu tun. Und ich kann nebenher den „Sprachführer für die Bundeswehr – Albanisch für Mazedonien und den Kosovo“ studieren. Das Bundessprachenamt in Hürth fordert auf der letzten Seite die Soldaten auf, es sofort zu melden, falls ihnen ein wichtiger Satz auffalle, den der Sprachführer womöglich vergessen hat.
O-Ton: „Bundeswehrangehörige! Wir wollen diesen Sprachführer besser machen! Dazu brauchen wir Ihre Hilfe! Bitte schreiben/faxen Sie uns oder rufen Sie uns an! Teilen Sie uns Ihre Vorschläge mit! Vielen Dank!“
Kein Witz. Sechs Sätze, sechs Ausrufezeichen. So bittet die Bundeswehr. Ich habe eine knisternde low-fi-Aufnahme aus den 30er Jahren im Ohr, die mit den Sätzen ein ganzes Volk eint. Nach meinem siebten Peja kommen Agron und Besi. Endlich. Ring frei für kulturelle Missverständnisse.
Wir eröffnen unsere Schlacht um die Nacht in einem kleinen Club namens „la linea“. Auf dem Schild über dem Eingang salutiert dieses Männchen, weiß, aus einem Strich gezogen, das in den 70ern durch die Werbepausen schimpfte und später Werbung für Wundsalbe machte. Lui heißt es.
Wundsalbe ist das, was ich jetzt für meine Seele brauche. Agron besorgt Peja für alle. Wir verstehen uns ohne Worte.
Der Club besteht aus einem einzigen kleinen Raum, nicht größer als ein Wohnzimmer. Zwei DJs legen Elektronisches auf die Plattenteller – moderne Marschmusik. Die Wände sind roh, zerfledderte Poster hängen vom Backstein, der Sauerstoffgehalt ist auf ein Zehntel reduziert. Stickig, eng und laut. Die Party könnte auch im Hinterhof irgendeines Berliner Szene-Ghettos laufen. Kein Platz zu tanzen, kein Raum für Gespräche. Wir verlassen den Club und fahren weiter zum „Emona 2000“. Dort versprechen mir die Jungs „sehr hübsche“ Frauen und albanische Live-Musik. Ich bleibe skeptisch.
Vor der Tür des „Emona 2000“ parkt eine weiße Stretch-Limousine mit dem Werbebanner der Bar, das Interior des Ladens erinnert an eine gute Pizzeria – nur etwas größer. Knapp zwanzig runde Tische sind im Raum verteilt, an denen jeweils drei bis fünf Kosovo-Albaner zwischen 20 und 35 Jahren sitzen. Vorne eine kleine Bühne, auf der ein junges Mädel singt. Davor eine Tafel, an der sechs weitere Ponys Stellung bezogen haben, sich mit kleinen Rougespiegelchen schminken und Cocktails trinken – das Gesicht und die sündig-roten Lippen immer den Männern zugewandt.
Das Programm des Abends verläuft wie die vergangenen Tage nach klaren Regeln: Eine der herausgeputzten Perlen singt, die anderen stehen entweder an ihrem Tisch, lassen lasziv die Hüften kreisen oder tanzen Hand-in-Hand an den Typen vorbei durch die Tischreihen.
Besi grinst mich vieldeutig an. Ich kneife skeptisch die Augen zusammen, nehme einen Schluck Bier und zünde die erste Bombe. „Hey, versteh mich nicht falsch. Aber das ganze Dingen hier erinnert mich … irgendwie … an … einen Viehmarkt.“
 Besi begreift nicht. Als ich nachsetze, heben sich meine Mundwinkel – beflügelt und leichtsinnig von den etlichen Runden Peja. „Komm, der Laden voller Typen, vorne die einzigen Perlen, die mit dem Gesicht zu uns stramm stehen, sich zwischendrin aufbretzeln und dann nacheinander auf die Bühne tippeln, um sich zu präsentieren.“ Ich schürze meine Lippen und schwenke meine Handfläche abwiegend von rechts nach links. „Gute Muskeln, weiße Zähne, gebährfreudiges Becken – gekauft.“
Besi begreift nicht. Als ich nachsetze, heben sich meine Mundwinkel – beflügelt und leichtsinnig von den etlichen Runden Peja. „Komm, der Laden voller Typen, vorne die einzigen Perlen, die mit dem Gesicht zu uns stramm stehen, sich zwischendrin aufbretzeln und dann nacheinander auf die Bühne tippeln, um sich zu präsentieren.“ Ich schürze meine Lippen und schwenke meine Handfläche abwiegend von rechts nach links. „Gute Muskeln, weiße Zähne, gebährfreudiges Becken – gekauft.“
Der Groschen fällt. Besi reißt erschrocken die Augen auf. „Nein, nein, nein, Bastian. Das ist kein Strip-Club oder so. Nichts schlimmes. Das ist okay.“ Er stoppt und überlegt. „Aber wenn dir eines der Mädchen gefällt, dann kannst du sie morgen ruhig treffen.“
Pause.
Ich greife zu meinem Peja und hake das Thema unter kulturellen Missverständnissen ab. Besi und ich sollten besser beim Bier bleiben und die übrigen Schlachtfelder meiden.
Agron stößt mich von der Seite an, als die nächste Polonaise an uns vorbeimarschiert. „Oh, my heart is beating for her.“ Agron zeigt auf eine Maus in einem smaragdgrünen Polyester-Kleid. Ich bin irritiert. Agron zeigt bei jeder Runde auf eine andere Perle.
„Ähm, I think something deeper is beating for her”, entgegne ich und greif mir in den Schritt. Er lacht und schlägt mir auf die Schulter. Mit jeder Runde Bier und Polonaise verstehen wir uns besser. Den Programmpunkt für morgen „visit of cimic store – Lachen helfen“, irgendein humanitäres Prestige-Projekt der Bundeswehr, bei dem Hilfsgüter verteilt werden, schreibe ich in Gedanken ab. Ich begreife: Durch die latente Bedrohung in einem Krisengebiet und der ständigen Konfrontation mit seiner Endlichkeit wird dem Menschen gezeigt, dass nur der Moment zählt. Okay … Bei mir reichte für diese Erkenntnis bereits die Kosovo-Kindergeburtstagstour in der olivgrünen Kitastätte.
Eine wirkliche Eskalation droht in dieser Nacht nur bei einer einzigen Situation: Ich habe eine Runde Bier geordert. Irgendein Cousin aus der Sippe, der sich später mit Driti unserem Trupp angeschlossen hatte, hängt auf Toilette. Wir stoßen an. Aus Höflichkeit, damit der Bursche nicht außen vor bleibt, proste ich mit meiner Pulle auf seine Flasche, die neben mir einsam auf dem Tisch wartet. Die Stimmung kippt schlagartig. Besi verschluckt sich. Blicke fixieren mich. Die Szenerie erstarrt. Stumme Augen, schmale Lippen. Nachdem der Klang der Glasflaschen verhallt ist, legt sich absolute Stille über die Runde. Ich schicke einen stummen Fluch gen Himmel:
Liebes Bundessprachenamt in Hürth, ich hätte da noch eine Ergänzung für den Sprachführer der Bundeswehr – mehr eine Warnung, die Sie doch bitte aufnehmen sollten: Stoßen Sie niemals mit Ihrem Flaschenboden auf den Flaschenhals eines Albaners! Es heißt: „Isch ficke deine Mutter!“
Driti prustet los, hält mir seine Hand zum Abschlagen hin. Ficker-Flosse. Die übrigen Jungs stimmen ins Gelächter ein. Ich atme durch. Die Situation ist erstmal gerettet. Nur mit dem Typen, dessen Mutter ich gevögelt habe, werde ich nicht mehr so richtig warm. Die Lage ist ruhig, aber nicht stabil. Um vier Uhr endet die Nacht. Ich habe Schlagseite, und Agron fährt. Andere Länder, andere Deadlines.
Als ich am nächsten Morgen um kurz vor acht mit gepackter Tasche und dickem Kopf in die Hotelbar komme, arbeiten Besi und Agron bereits, machen mir ein Omelette mit Schafskäse und einen Latte Macchiato. „Teufelskerle, diese Kosovaren“, denke ich und würge das Omelette runter.
Eigentlich mag ich Oberstleutnant Jens Darius Müller. Bei jeder Gelegenheit rauchen wir, scherzen und lachen. Er versteht seinen Job als PR-Offizier. Der Sechzehnjährige kommt ins Straucheln. Sein Bild des stereotypen Soldaten – einfältig, stumpf und obrigkeitshörig – bröckelt. Langsam beginne ich den Mensch unter der Uniform zu entdecken. In einer ruhigen Minute erzählte mir Müller, sein größter Wunsch sei es, nach dem Einsatz barfuß über eine Wiese zu laufen – ohne Soldatenstiefel und Uniform. Nur das frische feuchte Gras zwischen den Zehen spüren. Just like a fucking Hippie. Wie gefangen die arme Sau wirklich ist, begreife ich erst am heutigen Tag.
 Den Lachen-helfen-Scheiß kann ich mir in meinem Zustand nicht geben, fällt aus. Müller und ich sprechen stattdessen die einzelnen Geschichten durch und tauschen Fotos aus. Anschließend begleitet er mich zu einem Souvenir-Shop in Pristina und zeigt mir, dass ein Leben in Uniform nicht spurlos bleibt.
Den Lachen-helfen-Scheiß kann ich mir in meinem Zustand nicht geben, fällt aus. Müller und ich sprechen stattdessen die einzelnen Geschichten durch und tauschen Fotos aus. Anschließend begleitet er mich zu einem Souvenir-Shop in Pristina und zeigt mir, dass ein Leben in Uniform nicht spurlos bleibt.
Ich will einer Freundin eine Shisha kaufen, versuche zu pfeilschen, beweise beeindruckendes Verhandlungsgeschick und bekomme am Ende für 45 Euro noch ein ganzes Päckchen Apfeltabak und Kohleplättchen geschenkt. Sauber gefeilscht für einen dämlich Deutschen.
Der Verkäufer läuft um die Theke zu Müller und greift in eines der Regale am Eingang. Gestern hatten meine Albaner nur in höchsten Tönen von den KFOR-Truppen gesprochen, seien froh, dass sie dem Land Ordnung und Sicherheit bringen.
„Für Sie habe ich auch noch etwas“, sagt der Verkäufer lächelnd und hält dem Oberstleutnant einen ganzen Korb mit Räucherstäbchen hin. Ein surreales Bild, wenn ein Albaner einem Soldaten im Tarnanzug einen Korb voller Hippie-Scheiße anbietet. Müller schnappt sich ein Paket. Wir gehen zurück zum Wagen. Ich frage, welche Duftrichtung er ausgesucht hat. Müller schaut mich irritiert an. Seine Finger gleiten zur Packung und zucken zurück. Er verlässt die Klimaanlage des Nissans, setzt seine Mütze auf und schmeißt die Räucherstäbchen in den nächsten Mülleimer. Bäm – und ich bin baff.
Müller meint nur: „Da hätte wer weiß was drin sein können.“ Der Sechzehnjährige denkt: „Alter, was haben die nur aus dir gemacht? Barfuß über eine Wiese! Erinnerst du dich?“
Nochmal: Der Typ in dem Souvenir-Shop hatte keine Ahnung, dass wir seinen Laden betreten würden. Er nahm einen Korb voller Räucherstäbchen aus der offiziellen Auslage seines Geschäftes. Müller hatte die freie Wahl zwischen vierzig verschiedenen Paketen. Dennoch war er davon überzeugt, dass in dieser fingerdicken Packung, die stank wie ein orientalischer Puff, eine Splitterbombe versteckt war. That’s paranoid! Und doch irgendwie verständlich.
Der Sechzehnjährige und ich beschließen, dass diese ganze Soldaten-sind-Mörder-Sache doch irgendwie komplexer ist, und machen uns bereit für die letzte Lektion: den Rückflug mit der Transall nach Deutschland.
Bis eins muss ich eingecheckt haben. Fräulein Pichler und Oberstleutnant Müller verabschieden sich, und ich arbeite mich bis zur Abflughalle vor. Bundeswehr-Soldaten, die ihren viermonatigen Einsatz hinter sich haben und jetzt nach Hause wollen, füllen die Halle. Die Männer sind ruhig, aber nicht stabil. Ich lege mich lang auf eine orangefarbene Wartebank und versuche zu schlafen.
Fast vier Stunden später startet die Transall. Der Rückflug ist anders. Ich habe eine Jacke an und sitze näher am Cockpit – ein Unterschied von gut zehn Grad Celsius. Mich umgeben auch nicht die selben stoischen Gestalten wie zu Beginn meiner Reise. Die Männer fliegen nicht ihrem Einsatz entgegen, sondern zurück zur Heimat. Neben mir sitzt ein Soldat Marke Bulldogge, ein kräftiger Bursche Mitte dreißig, gut aussehend, erinnert mich an Lee Majors alias Steve Austin in der „Sechs-Millionen-Dollar-Mann“. Cooler Typ. Eigentlich. An seiner rechten Hand steckt ein breiter, silberner Ring. Unentwegt dreht er ihn, nimmt ihn ab, sieht ihn an, steckt ihn wieder auf.
Den meisten Soldaten geht es wie meinem Mister Austin. Sie wippen mit ihren Füßen, rutschen auf ihrer Bank hin und her, zerknautschen Wasserflaschen oder trommeln auf den Schenkeln. Unruhe keimt in den militärischen Reihen wie Unkraut in einem vernachlässigten Vorgarten.
Unter mehreren Sauerstoffmasken und einer Spitzhacke, die nahe der Luke an der Wand hängen, sitzt ein Typ und zeigt keinerlei Regung, starrt nur geradeaus ins Leere. Angst steht ihm im Gesicht. Der Bursche fällt eher in die Kategorie junger Bauer vom Land mit leicht schwulem Touch, der jetzt in sein Dorf zurückkehrt. Anscheinend ist das, was ihn zu Hause erwartet, schlimmer als jeder Krieg.
Je näher die Heimat kommt, desto deutlicher kristallisieren sich die einzelnen Schicksale heraus. Die Gesichter der einen gefrieren zu immer groteskeren Masken, bei den anderen kann ich körperlich das Feuer spüren, das mit den schwindenden Meilen in ihrer Brust immer heller und heißer zu lodern beginnt. Die Kontrolle entgleitet ihnen langsam. Ich atme tief ein und ziehe meine Jacke zu.
 Oberstleutnant Björn Sträter fragte während unseres Abendessens, wie ich die Parade mit den Ehrungen und Auszeichnungen der Fernmeldern empfunden habe. Ich antwortete, dass sich in den vergangenen Tagen durchaus mein Bild von der Bundeswehr verändert habe, dass mich viele der Soldaten beeindruckt hätten. Etwa der Wille, bei so einer Parade einfach mal zwei Stunden im Regen stramm zu stehen. Reife Leistung. Allerdings begriff ich den Sinn nicht.
Oberstleutnant Björn Sträter fragte während unseres Abendessens, wie ich die Parade mit den Ehrungen und Auszeichnungen der Fernmeldern empfunden habe. Ich antwortete, dass sich in den vergangenen Tagen durchaus mein Bild von der Bundeswehr verändert habe, dass mich viele der Soldaten beeindruckt hätten. Etwa der Wille, bei so einer Parade einfach mal zwei Stunden im Regen stramm zu stehen. Reife Leistung. Allerdings begriff ich den Sinn nicht.
Der Oberstleutnant schwieg.
Die Kontrolle, die ich erleben durfte, bedeutet Disziplin und Geradlinigkeit und das wiederum Leistungsfähigkeit und Produktivität. Es hat mich beeindruckt, dass Soldaten etwas erreichen können – mehr erreichen können, als sie allein zu im Stande wären. Ein Impuls, ein Befehl, ein Wahrheitsträger kommt und ohne energieraubende Gedanken, Emotionen oder Zweifel wird er umgesetzt. Das ist perfekte Effizienz. Auf der anderen Seite bedeutet diese Kontrolle Unfreiheit und Stillstand. Soldaten sind gefangen in einem grauen Betonlabyrinth, das nur einen einzigen – ihnen bestimmten – Weg heraus kennt.
Es ist herzergreifend jetzt diese Männer in der Transall zu sehen, wie sie mit jedem Kilometer, den sie ihren Familien und Freunden näher kommen, aus der Kontrolle fallen und endlich wieder barfuß über eine Wiese laufen können – wie waschechte Hippies.
* Name aus Gründen der nationalen Sicherheit geändert.
Die Story erschien im Ruhrbarone-Bookzine #5