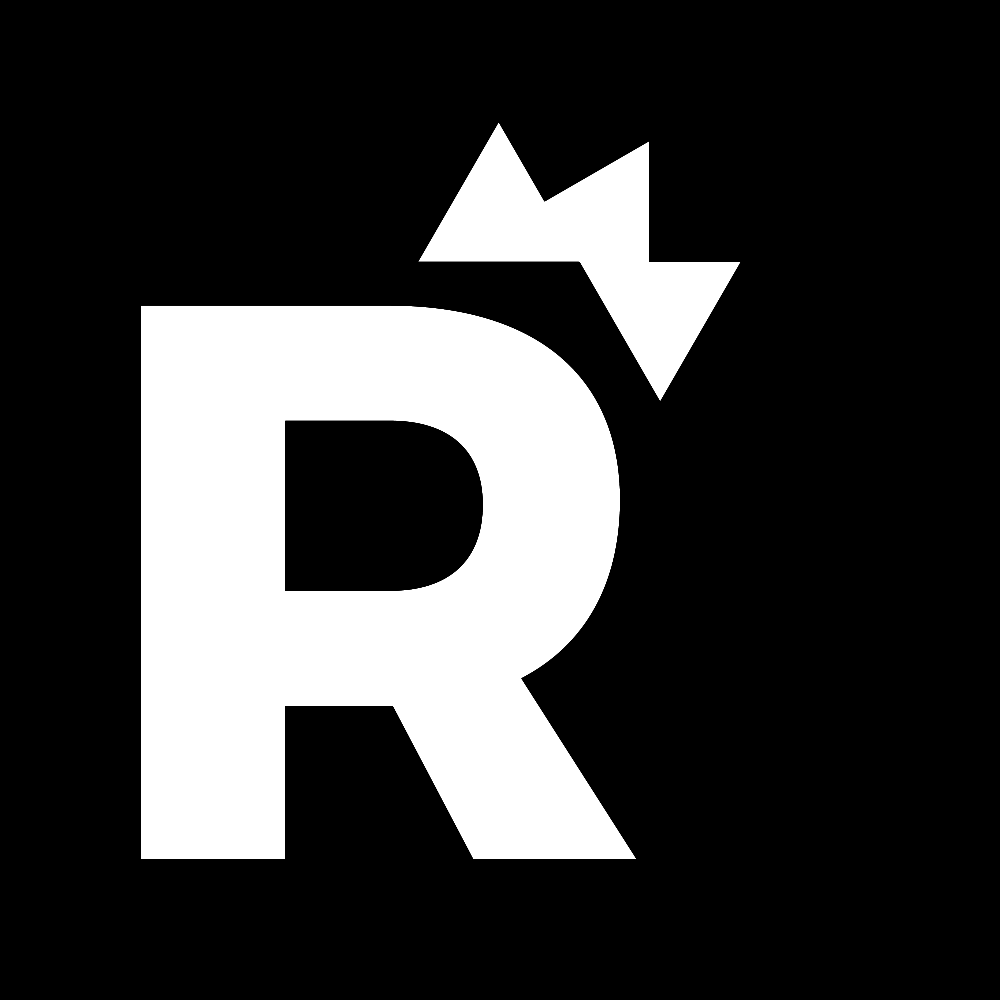In der vergangenen Woche wollte ich was Positives über die AGR schreiben. Ich hatte gehört, dass die Müllfirma des Regionalverbandes Ruhr, nach den Katastrophenjahren, nun endlich in 2007 wieder einen Gewinn eingefahren hat. Bei einem Umsatz von 100 Mio Euro zwar nur 7 Mio. Aber: Immerhin. Nach all den Hunnenmeldungen, die in der Vergangenheit kamen, dachte ich, schön mal was anders zu schreiben.
Ich habe also nachgefragt, wie es steht. Vor allem wollte ich den Jahresabschluss einsehen, damit man überprüfen kann, was sich hinter der Jubelmeldung verbirgt. Überraschend wurde mir mitgeteilt, dass der Jahresabschluss noch unter Verschluss sei, und nur die Eckzahlen, also die Jubelmeldung, verbreitet würde. Den echten Abschluss gebe es erst, wenn das Ruhrparlament den Abschluss abgesegnet habe.
Klar? Die Jubelarien soll man singen, aber man darf nicht nachschauen, welche Melodie gespielt wird. Seltsam.
Ich habe mir dann die Pressemeldung genau angesehen. Und dann sehe ich, dass die AGR immer noch überschuldet ist. Und zwar mit 3 Mio Euro. Gut, normalerweise muss die AGR deshalb ihren Betrieb einstellen und Insolvenz anmelden. Sonst macht sich der Geschäftsführer strafbar wegen Insolvenzverschleppung.
Aber da der AGR-Geschäftsführer Dietrich Freudenberger keine Insolvenz anmeldet, muss er eine so genannte positive Fortführungsprognose in der Tasche haben. Das bedeutet. Die Wirtschaftsprüfer der AGR glauben, die Firma kann sich aus eigener Kraft aus dem Schlamassel befreien. Sie könne also die Überschuldung abbauen. Deswegen geben sie diese Prognose ab.
Es bleibt also zu prüfen, ob die Wirtschaftsprüfer Recht haben. Dazu muss man wissen, dass die Prüfer nur das prüfen, was man ihnen vorlegt. Manchmal stellen sie Fragen, aber im Prinzip schreiben sie ab. Bei der AGR sagen sie, die baldige Einweihung der Müllverbrennungsanlage RZR II bringe die Wende zum Guten. Die Wirtschaftsprüfer schreiben also genau das auf. Um Freudenberger eine positive Fortführungsprognose zu geben.
In der weiteren Recherche musste ich mich also mit dem Projekt RZR II beschäftigen. Läuft es da rund oder krum?
Und dabei stoße ich auf folgende Geschichte: Kurz vor Ostern traf sich der AGR-Chef im Wintergarten der Müllverbrennungsanlage von Herten mit Vertretern des Abfallverbandes Ekocity, um eine existenzielle Krise zu bewältigen.
Denn ausgerechnet das RZR II stand unmittelbar vor dem Kollaps. Aus Unterlagen, die mir vorliegen, geht hervor, dass einer der größten Lieferanten der neuen Anlage im Dezember Insolvenz angemeldet hatte. Dabei sollte die Firma SSM Pfalz eigentlich ab Juli bis zu 60.000 Tonnen Müll im Jahr im RZR II verbrennen. Die AGR meldete beim Insolvenzverwalter der SSM einen Vertragsschaden von über 126 Millionen Euro an.
Um die Misere zu überwinden, musste AGR-Chef Freudenberger die Ekocity-Vertreter im Wintergarten überreden, Müllmengen an das RZR II abzutreten – obwohl Ekocity damit Millionen verliert. Das Überreden fiel Freudenberger offensichtlich nicht schwer. Der Verband vereinigt die kommunalen Entsorger aus mehreren Ruhrstädten. Freudenberger selbst ist einer von drei Geschäftsführern der Ekocity GmbH. Eigentümer der AGR ist der Regionalverband Ruhr (RVR). Gleichzeitig ist Ekocity ein Verband von Ruhrkommunen, die auch im RVR vertreten sind. Eine Pleite der AGR würde also auch sie schwer treffen. Deswegen schien es ihnen wohl offensichtlich leichter auf ein paar Millionen im RZR I zu verzichten.
Denn die Pleite der SSM kam für die AGR denkbar ungünstig. Denn, wie gesagt, nur dank einer positiven Fortführungsprognose kann die AGR überhaupt weiter arbeiten. Und genau diese Prognose war durch die Pleite des Müll-Lieferanten SSM gefährdet. Der Bau der Verbrennungsanlage RZR II wird über einen Millionen-Kredit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) finanziert. Als Garantie für ihr Geld hatten die Schwaben Bürgschaften der Lieferanten gefordert. Nach der Pleite der SSM hätte die LBBW den Kredit kündigen können. Damit wäre der Bau des RZR II gescheitert und die AGR an die Insolvenz gerutscht.
Nach kurzer Diskussion stimmte der Verband Ekocity einer Vertragsänderung mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein zu. Demnach werden ab 2009 jährlich rund 10.000 Tonnen Müll aus dem Sauerland vom RZR I auf die Anlage RZR II umgeleitet. Das Geld für die Verbrennung (über 20 Millionen Euro über die gesamte Vertragslaufzeit) kassiert dann nicht mehr der Verband Ekocity, sondern die AGR über ihre Tochter RZR II.
Das besondere dabei ist die Preisstruktur. Die SSM hatte der AGR zugesagt, 17 Jahre lang für jede Tonne verbrannten Müll 125 Euro an die AGR zu zahlen. Traumhafte und vor allem überhöhte Preise, denn nach Angaben des Insolvenzverwalters der SSM liegen die Marktpreise aktuell zwischen 80 und 100 Euro. Er schreibt: "Keiner dieser Verträge konnte kostendeckend erfüllt werden." Anders formuliert bedeutet das aber auch, dass nun Siegen-Wittgenstein, zu überhöhten Preisen an das RZR II liefern muss. Die Bürger im Sauerland bezahlen also mit ihren Müllgebühren die schlecht geplante Müllverbrennungsanlage in Herten. Prima, dass die Sauerländer da mitmachen.
Bis zum Schluss hat die AGR versucht, die SSM zu retten. Beinahe um jeden Preis. So war die AGR bereit 450.000 Euro in die marode Klitsche zu pumpen, wenn nur die SSM einfach nicht Insolvenz geht. Die AGR wollte sogar so auf Forderungen verzichten und die Verträge neu verhandeln. Hauptsache, SSM lebt weiter und mit der SSM die Hoffnung, das RZR II auszulasten.
Nun, das sollte nicht sein. Und so wird entgegen den Versprechungen nun kommunaler Müll aus dem Kreis Siegen Wittgenstein, der bislang im RZR I verbrannt wurde, in Zukunft im RZR II verbrannt. Damals hieß es, für das RZR II gebe es eine riesige Nachfrage nach Gewerbemüllkapazitäten. Das war dann wohl Geschwätz. Auch nach dem Ekocity-Deal beläuft sich der Vertragschaden für die AGR aus der Pleite der SSM auf umgerechnet über 100 Millionen Euro.
Zum Schluss stellen sich mir noch folgende Fragen: Wer ist Klaus Döbel? Und was hat der mit der AGR oder ihren Chefs und Ex-Chefs zu tun? Warum schließt seine Firma SSM einen Harakiri-Vertrag mit der AGR ab, der nur Verluste bringen kann? Wie immer bin ich unter david.schraven@ruhrbarone.de zu erreichen.

 Fotos gingen leider nur vom Handy. 🙂
Fotos gingen leider nur vom Handy. 🙂 Das Foto hab ich eine halbe Stunde später geschossen. 🙂
Das Foto hab ich eine halbe Stunde später geschossen. 🙂 Ging leider nicht anders. Die Hives waren zu fix für mein Handy
Ging leider nicht anders. Die Hives waren zu fix für mein Handy
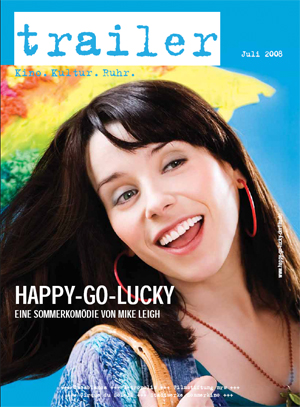



.jpg)