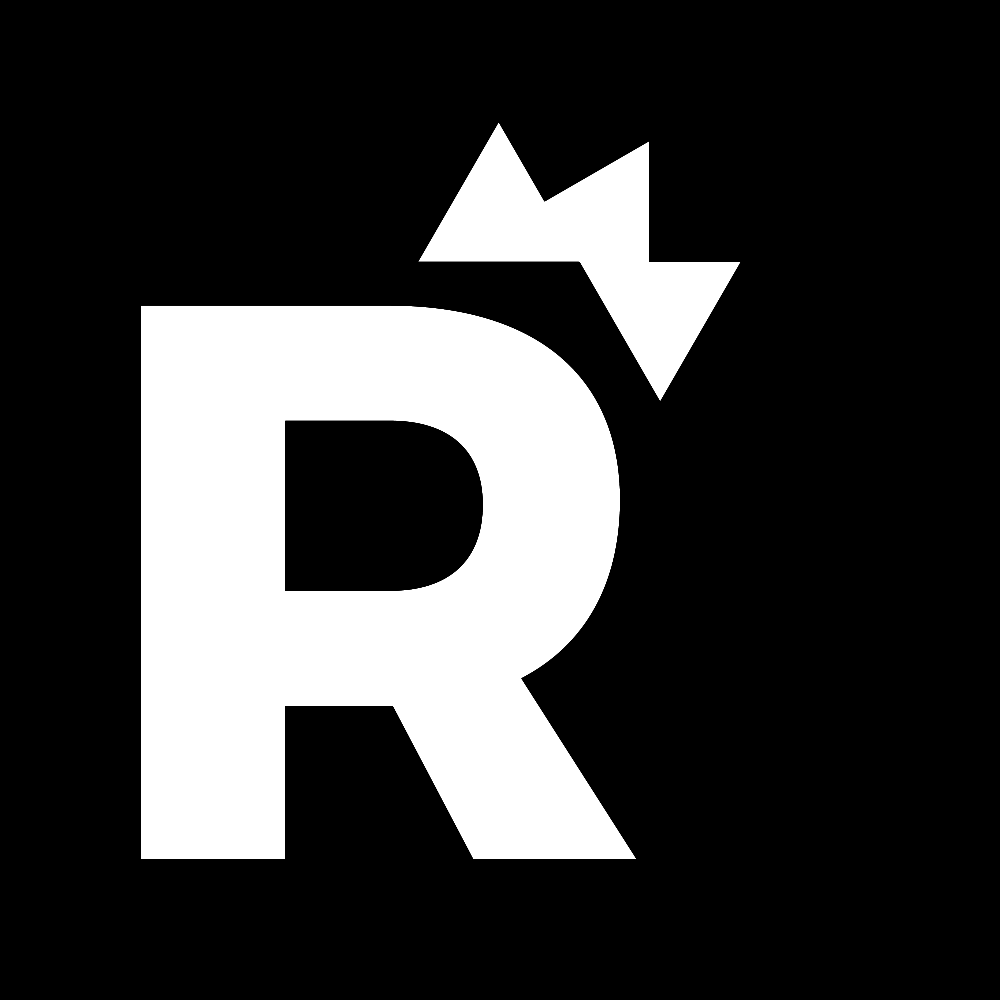Im Streit um die Zukunft von Thyssenkrupp geht es nicht nur um ein altes Stahlunternehmen im Ruhrgebiet, sondern um die Frage, ob der Preis, den Deutschland für die Energiewende zahlen wird, seine Deindustrialisierung sein wird.
Im Ruhrgebiet gehen die Stahlarbeiter wieder auf die Straße. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) machten sie im vergangenen Sommer deutlich, dass sie Zuschüsse für den klimaneutralen Umbau eines Hochofens in Duisburg erwarten, der künftig nicht mehr mit Kokskohle, sondern mit Wasserstoff betrieben wird. Anfang Mai demonstrierten sie an derselben Stelle auf der Wiese vor der Zentrale von Thyssenkrupp Steel dafür, dass sie beim Einstieg des tschechischen Investors Daniel Křetínský mitreden können, wie sie es aufgrund der Montanmitbestimmung, die den Arbeitern eine starke Stimme gibt, erwarten. Und sie forderten, dass weder Hochöfen stillgelegt noch Arbeiter entlassen werden und den klimaneutralen Umbau der Stahlwerke. Gestern forderten sie in Essen von Konzernchef Miguel López das Versprechen, dass ihre Jobs sicher sind und ihre Gewerkschaft bei allen Entscheidungen mitreden kann. Das hat Tradition in der Stahlbranche, aber genau mit der bricht López: Er verhilft BDI-Präsident Siegfried Russwurm als Vorsitzender mit seinem doppelten Stimmrecht der Konzernleitung zu Mehrheiten. Die Zeiten, in denen im Konsens entschieden wurde, scheinen vorbei zu sein. Der soziale Friede scheint dem Thyssenkrupp-Manager nicht mehr so wichtig zu sein. Es geht um das Überleben des Unternehmens.
Thyssenkrupp ist weltweit gesehen kein großer Stahlproduzent. In Duisburg betreibt das Unternehmen vier Hochöfen. Zwei zusätzliche Hochöfen sind Eigentum der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), einem Joint Venture, das der Konzern zusammen mit den Wettbewerbern Salzgitter und Vallourec betreibt. Im Jahr 2022 produzierte das Unternehmen nur neun Millionen Tonnen Stahl. Zwölf Millionen Tonnen hätte es bei entsprechender Nachfrage produzieren können. Weltweit reicht das nur für Rang 43 unter den Stahlkonzernen. 2022 lieferte der Branchenführer, die China Baowu Steel Group, ihren Kunden 131,84 Millionen Tonnen Stahl. Künftig könnten es nach unbestätigten Plänen nur noch gut sechs Millionen Tonnen sein.
Die Schwäche des Unternehmens ist zum Teil hausgemacht: Der Konzern verlor acht Milliarden Euro beim Bau eines Stahlwerks in Brasilien. Weil das Werk im Sumpf gebaut wurde, explodierten die Baukosten. Die mit der Errichtung der Anlage betraute chinesische Firma konnte die Preise nicht halten. Der Stahl aus Brasilien war am Ende teurer als der aus den deutschen Werken.
Doch solche Managementfehler sind nicht der Hauptgrund des Niedergangs von Thyssenkrupp, der nun schon Jahrzehnte anhält und an sein Ende kommt.
Das Unternehmen selbst ist ein Symbol des Niedergangs seiner Branche. Thyssenkrupp entstand 1999 durch die Fusion der Fried. Krupp AG Hoesch-Krupp mit der Thyssen AG. Krupp hatte da schon den alten Konkurrenten Hoesch geschluckt und Thyssen die Niederrheinische Hütte, die Deutsche Edelstahlwerke und die Hüttenwerke Oberhausen AG.
Hochöfen im ganzen Ruhrgebiet wurden stillgelegt. Im Landschaftspark Duisburg Nord kann man zwischen ihnen spazieren gehen, auf dem Gelände der ehemaligen Henrichshütte in Hattingen ist heute ein Museum und ein empfehlenswertes Restaurant. Auf dem Gelände der ehemaligen Hermannshütte im Dortmunder Stadtteil Hörde wurde der Phoenixsee angelegt und an seinen Ufern ein neuer Stadtteil gebaut.
Stahl aus Deutschland wird nicht mehr in denselben Mengen wie früher benötigt und in vielen Branchen ist er preislich auch nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Stahlindustrie im Ruhrgebiet hatte viele Vorteile: Die Stahlkunden saßen ganz in der Nähe, mit der Kohle gab es günstige Energie vor Ort und der Rhein und das engmaschige Bahnnetz garantierten eine gute Verkehrsanbindung.
Viele Unternehmen, die früher den Stahl aus dem Ruhrgebiet verwendet haben, gibt es heute nicht mehr oder sie kaufen ihn auf dem Weltmarkt günstiger ein. Stahlwerke im Ausland liegen oft nicht an Flüssen, sondern am Meer und können von großen Frachtern direkt angesteuert werden. Die Löhne sind meistens ebenso niedriger wie die Umweltauflagen, die boomenden Industrien in Ländern wie Südkorea oder China bilden einen großen Absatzmarkt. Die wichtigsten Abnehmer der Stahlindustrie in Deutschland sind die Automobilindustrie, der Maschinenbau und die Bauindustrie. Die Automobilindustrie benötigt immer weniger Stahl und produziert zunehmend im Ausland, der Maschinenbau rechnet mit Rückgängen und in Deutschland wird immer weniger gebaut.

Die Stahlindustrie im Ruhrgebiet hat fast alle einstigen Standortvorteile verloren. Den Rest gibt ihr nun die Energiewende. Schon vor zwei Jahren antwortete der damalige Staatssekretär in Habecks Wirtschaftsministerium, Patrick Graichen, in einem Interview mit dem Öko-Aktivisten Michael Liebreich auf die Frage, welche Folgen der teure, grüne Wasserstoff für die Industrie in Deutschland habe: „Im Wesentlichen wird es wahrscheinlich bedeuten, dass energieintensive Industriezweige mit Produkten, die man auch an anderen Orten einfach herstellen könnte, dorthin gehen, wo es den Strom für ein bis zwei Cent gibt.“ In Deutschland liegt der Industriestrompreis aktuell bei um die 18 Cent pro Kilowattstunde.
Wasserstoff kommt auch in Duisburg nicht aus dem Boden. Er wird mit Strom durch Elektrolyse hergestellt. Ihn in Deutschland herzustellen ist bei den hiesigen Strompreisen teuer. Besser ist es, ihn irgendwo zu produzieren, wo zum Beispiel der Strom in großen Mengen billig mit Solarenergie hergestellt werden kann: In Südeuropa zum Beispiel, in Nordafrika oder auf der arabischen Halbinsel. Doch den Wasserstoff dann über Pipelines oder mit Schiffen nach Deutschland zu bringen, kostet ebenfalls viel Geld. Es ist günstiger, den Stahl dort zu produzieren, wo Energie günstig zu haben ist. Stahlproduktion hat in Deutschland keine Zukunft. Dass die Bundesregierung und einzelne Bundesländer trotzdem mit Milliardenbeträgen einige wenige Standorte absichern, liegt daran, in Krisenzeiten eine gewisse Grundversorgung mit Stahl sicherstellen zu können. Es geht um Absicherung, mehr nicht.
Die Geschichte des Niedergangs der Stahlindustrie klingt fast wie die der Steinkohle: Ab dem 19. Jahrhundert bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine der Säulen von Wachstum und Wohlstand, konnte sie sich spätestens ab den 60er Jahren weder im internationalen Wettbewerb halten noch gegenüber günstigeren Energieträgern wie Öl, Kernkraft und Gas bestehen. Eine Zeche nach der anderen wurde geschlossen, eine immer geringere Zahl wegen der Versorgungssicherheit offen gehalten, bis Ende 2018 mit Prosper-Haniel in Bottrop das letzte deutsche Bergwerk schloss.
Aber ganz so einfach wie mit der Kohle ist es mit dem Stahl nicht. Und sein sich abzeichnender endgültiger Niedergang ist ein Menetekel für die Industrie in Deutschland.
Seit den späten 90er Jahren blieb der Anteil der Industrie an Deutschlands Wertschöpfung stabil. Auch wenn es seit Jahrzehnten immer wieder beschworen wird, ist Deutschland bislang keine postindustrielle Gesellschaft. Der Wohlstand des Landes hängt vom Export von Autos, Industriemaschinen, Elektrotechnik und chemischen Produkten ab. Im Gegensatz zu den USA hat Deutschland weder Apple noch Microsoft, OpenAI oder Alphabet. Es gibt auch kein deutsches Hollywood, das weltweit Milliardenumsätze macht. Deutsche Filme will kaum jemand sehen. Das ist im Ausland nicht anders als in Deutschland selbst. Und bei Technologien wie Raumfahrt, Gen- oder Kerntechnik, Künstlicher Intelligenz spielen die hiesigen Unternehmen mit wenigen Ausnahmen wie Biontech auch keine Rolle: Über Jahrzehnte hat die Politik, getrieben von NGOs und einem grünen Zeitgeist, das Regelkorsett so eng geschnürt, dass technologische Entwicklungen nicht mehr wirtschaftlich erfolgreich umgesetzt werden können.
Doch die Industrie braucht passende Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein. Dazu gehören zum Beispiel bezahlbare Energiekosten und eine sichere Energieversorgung. Beides ist nicht gegeben: Die Energiepreise in Deutschland gehören zu den höchsten der Welt und das Stromnetz an der Grenze seiner Belastbarkeit. Dass es bei Tesla Anschläge auf Industrieanlagen gibt, ist auch kein Standortvorteil. Zu diesen Problemen kommt ein immer größer werdender Facharbeitermangel und hohe Steuern und Abgaben hinzu. Dass die Infrastruktur bröselt, Schienen und Straßen in erbärmlichem Zustand sind, gehört längst zur Alltagserfahrung der Menschen in diesem Land.
Die Energiewende führt zu höheren Kosten. Der klimaneutrale Umbau der Wirtschaft, aber auch des Wohnungsbestandes und der öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern und Verwaltungsgebäuden zerstört den in Jahrzehnten geschaffenen Kapitalstock des Landes, die Basis seines Wohlstandes. Es wird höchstens um- und kaum neu gebaut. So könnten von sechs Hochöfen in Duisburg bald nur noch ein oder zwei übrigbleiben. Und das, was gerade Thyssenkrupp passiert, wird wahrscheinlich auch auf BASF, Bayer, Volkswagen, ZF Friedrichshafen, Evonik oder Lanxess zukommen: Sie werden mit immer weniger in Deutschland hergestellten Produkten auf dem Weltmarkt mithalten können, ihre Produktion ins Ausland verlagern oder herunterfahren.
Auch die vielen mittelständischen Unternehmen werden immer mehr unter Druck geraten: Die innovativen „Hidden Champions“, die global erfolgreich und zum Teil in ihren Nischen Weltmarktführer sind, wird es ebenso treffen wie die vielen Zulieferer, deren Kunden die großen Industrieunternehmen sind.
Heute trifft es Duisburg, morgen vielleicht Wolfsburg, Leverkusen oder Ingolstadt.
Spricht man auf den Demonstrationen der IG mit den Arbeitern, die für ihre Jobs bei Thyssenkrupp auf die Straße gehen, fällt auf, dass sie hinter der Energiewende stehen. „Unser Herz aus Stahl hat eine grüne Zukunft“ kann man auf den Bühnen sehen, von denen aus Thyssenkrupp-Betriebsrat Tekin Nasikkol flammende Reden hält, immer wieder den Stahlhammer schwenkt und Wirtschaftsminister Habeck die Bedeutung der Industrie beschwört und auf den Westen der Demonstranten. Schade, dass das nicht stimmt. Und die Gewerkschaft es ihren Mitgliedern auch nicht sagt.

Sicher, grüner Stahl hat eine Zukunft, aber nicht, wenn er in Deutschland hergestellt wird, wo erneuerbare Energie teuer und knapp ist. Er hat eine Zukunft in Regionen, in denen Sonne und Wind in ausreichendem Maß zur Verfügung stehen. Duisburg gehört nicht dazu und der Staat hat nicht soviel Geld, diesen Nachteil mit Subventionen ausgleichen zu können.
Und diese Tatsache ist dabei, zu einem immer größeren Problem der Industrie zu werden. Fast überall auf der Welt ist Energie, auch aus Sonne und Wind, preiswerter zu haben. Andere Staaten wie Frankreich nutzen zudem weiterhin die CO2-neutrale Kernenergie zur Stromerzeugung und bauen neue Kernkraftwerke. Jahrzehnte der Technologieskepsis und eine staatlich gestützte Protestkultur haben dafür gesorgt, dass Deutschland bei modernen Technologien abgehängt wurde und die Abhängigkeit von den traditionellen Industrien hoch blieb. Nun sorgt die Energiewende dafür, dass genau diese Industrien aus dem Land verdrängt werden könnten. Der Ökonom und Mathematiker Franz Josef Radermacher, einer der Väter der Idee einer Ökosozialen Marktwirtschaft, kritisiert seit Jahren die deutsche Energiewende als klimanationalistisch, teuer und ineffektiv. Im vom Handelsblatt unterstützten Podcast „bto – beyond the obvious“ spricht sich Radermacher dafür aus, bei der Reduktion von CO2 international zu denken. Anstatt in Deutschland die Wirtschaft zu ruinieren und Milliarden dafür auszugeben, Häuser in Plastik einzupacken, um geringe Mengen des Treibhausgases einzusparen. Er will internationale Investitionen da, wo sich für jeden eingesetzten Euro am meisten CO2 einsparen lässt. Die Industrie, aber auch die Verbraucher könnten so teilweise entlastet werden.
Gut möglich, dass eine solche Politik auch dauerhaft Mehrheiten findet und sowohl den ökologischen Umbau als auch die Demokratie nicht gefährdet. Die radikale ökonationale Politik führt zu Wohlstandseinbußen und Unsicherheit und beides nutzt vor allem populistischen Parteien wie der rechtsradikalen AfD, aber auch den eher linksnationalen Wagenknechten. Die Wirtschafts- wie die Klimabilanz der Ampel sind schlecht. Und wenn der Kurs nicht bald geändert wird, werden radikale Parteien weiter an Zustimmung gewinnen. Deindustrialisierung und Wohlstandsverluste könnten dafür sorgen, dass jede Form der Klimapolitik in Misskredit gerät und die Stabilität der bundesrepublikanischen Demokratie gefährdet wird.
Duisburg ist schon seit Jahren eine Hochburg der AfD. Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt die Partei im Wahlkreis Duisburg II, in dem viele Beschäftigte der Stahlindustrie arbeiten und die Folgen des wirtschaftlichen Niedergangs für jeden sichtbar sind, 13,8 Prozent der Stimmen. Bundesweit erreichte die AfD 10,4 Prozent. In Gelsenkirchen, der anderen sich in einer Dauerkrise befindenden Stadt im Ruhrgebiet, sieht es in den Umfragen immer mal wieder so aus, als ob es der AfD im kommenden Jahr sogar gelingen könnte, ein Direktmandat zu gewinnen.
Im Ruhrgebiet kann man die Folgen der Deindustrialisierung studieren. Die Region gehört heute zu den ärmsten des Landes. Viele gut bezahlte Jobs in Betrieben mit starken Gewerkschaften fielen weg. Die neuen Arbeitsplätze, und es gibt sie, wenn auch nicht in ausreichender Zahl, sind meistens schlechter bezahlt. Viele Akademiker, die an den zahlreichen Hochschulen der Region studieren, ziehen nach ihrem Abschluss weg. Ein Brain Drain, der die Region zusätzlich schwächt.
Wer nicht möchte, dass das Modell Ruhrgebiet auf ganz Deutschland übertragen wird, sollte sehr genau hinschauen, was gerade bei Thyssenkrupp passiert. Es könnte ein prominenter Vorreiter des Niedergangs der Industrie in Deutschland werden.
Mehr zu dem Thema:
Thyssenkrupp-Betriebsrat wünscht sich grüne Stahlproduktion mit Fantasiawasserstoff
Bundesregierung will 500.000 Industriearbeitsplätze auf dem Altar der Energiewende opfern