
Unsere Gastautorin Anna Maria Loffredo teilt Philipp Hübls kritische Sicht auf das postmoderne Ideologienbündel.
Ich verstehe mich offen gestanden als Frau, ziemlich genau als Cis-Frau, jedoch nicht als pansexuell. Können Sie mir hier schon nicht mehr folgen? Dann verfügen Sie nicht über das Distinktionsvermögen der kreativen Klasse, die sich betont progressive Werte zuschreibt. Selten lassen Köpfe, die sich als Innovationstreiber des moralisch einwandfreien Lebens verstehen, eine Möglichkeit aus, sich als solche rhetorisch versiert gegenüber Nicht-Wissenden in Szene zu setzen. Gern nehmen sie mit blasierten Meinungen den Mittelpunkt des Geschehens ein, umso weniger hinterlassen sie Eindruck mit konzisen Argumenten, geschweige denn mit nennenswerten Qualifikationen. „In der kreativen Klasse spricht man die Sprache der neuen Moral“ (S. 209), so Philipp Hübl, der als sprachwissenschaftlicher Philosoph einen unterhaltsamen und erhellenden Duktus in seinem neuen Sachbuch „Moralspektakel“ darbietet. Nicht nur Akademiker, pardon intellektuelle Elite:innen, werden durch Hübls profunde Lupe mit statistischem Wissen und einem konsequenten Argumentationsstrang überzeugt werden.
Heutzutage steht sowohl ein Autor in Gefahr, wegen seiner wissenschaftlichen Leistung in einen öffentlichen Moralkampf samt unerbittlichem Shitstorm gesogen zu werden, als auch Rezensenten von Hübls stimulierender Gegenwartsanalyse. Man liefert sich demjenigen Milieu aus, das für höchste Bildungsanstrengungen im Zeitgeist einerseits steht, schönste Beispiele kognitiver Dissonanz andererseits gleich mitliefert. Ich wage es, Aussagen eines weißen männlichen Wissenschaftlers zur Genderforschung aus Gründen der Wissenschaftsgüte mitzugehen, die der „Community“ arg weh tun. Dabei ist Hübl bei seiner wissenschaftlichen Vorgehensweise der Übermittler von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es bereits gibt, die er aber mit seiner Brille als Spiegelungsfläche aufeinander logisch bezieht, wie im Beispiel einer Studie der Psychologin Therese Söderlund: „Je stärker die Genderperspektive in der Forschung, desto geringer die wissenschaftliche Qualität“ (S. 257). Wumms!
Wenn also besonders Gebildete der postkolonialen Theorie doch recht schmalspurige Kategorien als Erklärungsmuster angeblicher Diskriminierungen fordern, dann geht Hübl in messerscharfe Umkehrschlüsse. Dem Anspruch auf absolute Großerzählungen begegnet Hübl mit kausalen Umkehrungen wie: „Geometrie ist keine griechische Wissenschaft, nur weil Euklid sie formuliert hat“ (S. 268). Doppelwumms!
Wenn Moral die allgemeine Begründung gesellschaftlichen Zusammenlebens ist, was motiviert also das Handeln von Menschen in unserer Zeit? Bestenfalls ist Mündigkeit der Nukleus verantworteter Selbstbestimmung in sozialen Zusammenhängen. Hübls These lautet, dass sich unsere Alltagsmoral fundamental von einer universellen Ethik der Menschenrechte unterscheide (S. 19). Er plädiert dafür, die universelle Ethik der Gerechtigkeit zu verfolgen. Nötig seien aber langfristiges antizipieren und multiperspektivisch abwägen können, abseits einer Gesinnung eher wie ein Richter zu denken, um bestenfalls ein ausgewogenes Urteil zu finden. Leider gelten öffentliche Inquisitionen gegenwärtig zum The New Normal im Miteinander, pardon autre fois: im Gegeneinander. Denn eigentlich ist es ziemlich einfach: „Zivilisiert zu streiten kann man schon in der Schule lernen“ (S. 280). Kein Wunder, dass man gerade in diesen Tagen den Eindruck gewinnen kann, dass an einigen Universitäten sehr große Kinder ein steuerfinanziertes Studium dafür nutzen, nicht mehr hinreichend Toleranz für die guten Argumente anderer zu haben. Vielmehr wird ein Stammesdenken in Wort und Tat radikal praktiziert, das die eigenen propagierten Werte von Offenheit, Toleranz oder Meinungsvielfalt unterminiert und konterkariert.
Als ehemaliger Gastprofessor an der Universität der Künste in Berlin, die seinen Vertrag – warum auch immer – nicht verstetigt hat, gehört Hübl selbst der sog. kreativen Klasse an. Er weiß um seinen Ort während des forschenden Tuns und gibt zu, selbst einer progressiven Urteilsverzerrung erlegen gewesen zu sein. Daher spricht er in seinem Buch eine Einladung aus, blinde Flecken, d.h. vorschnelles und manifestes Urteilen zu revidieren, auch wenn es Identitäts- und Weltanschauungsarbeit abverlange. Gleiches setze ich für diese Rezension voraus. Autoritäres Verhalten und Wissenschaftsfeindlichkeit seien laut Hübl eben nicht ausschließlich typisch für Traditionalisten/Konservative (S. 32), sondern auch für diejenigen, die anderen ungefragt ihre Weltsicht unter Einsatz des Glottisschlags oder auch hoch diversitätssensible Begriffsneukreationen wie Gäst:innen, Witwer:innen oder Teenager:innen aufdrängen. Was allerdings nach Moral aussieht, ist nicht zwangsläufig moralisch (gut). Und hier zerlegt Hübl mit seiner wohltuenden Nüchternheit einige Annahmen, indem er sich auf eine breite Datenbasis stützt. Dass das nicht allen – von Sprachmagie erfüllten feministischen and new masculinity – Lesern schmeckt, liegt in der Natur der Datenlage. Auf jeder Buchseite findet man mindestens eine Fußnote, in der Regel bis zu fünf, wodurch der Quellenanhang ganze 30 Seiten zu den 280 Textseiten im Buch umfasst.
Zur Darstellung des Kernanliegens „Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht“ unterteilt Hübl sein Buch in einen deskriptiven und einen normativen Teil. Zunächst geht es um die Beschreibung des tatsächlichen Handelns, danach um die wertende Betrachtung und Einordnung. Allein wegen der moralisch dichten Begriffe (vgl. Bernard Williams), ist es zwangläufig notwendig, viele anschauliche und plausible Beispiele aus Politik und Medien im ersten Teil zu nennen, damit man Hübls komplexen Aufriss folgen kann. Manches wiederholt sich aus Hübls vorangegangenen Buch „Die aufgeregte Gesellschaft“ (2019, C. Bertelsmann Verlag), aber das treffsichere Argument an sich bleibt. Gerade weil wir heutzutage über besonders feinsinnige moralische Detektoren verfügen, wird die Gesamtstimmung umso gereizter für empfundene Ungerechtigkeiten. Die Empörung folgt sogleich. Tatsache ist aber, dass die Menschenrechtslage besser geschützt ist, denn je. Dennoch verfällt die Welt moralisch nach Ansicht von 12 Millionen Befragten in 60 Ländern über die letzten 70 Jahre, so Hübls metaanalytischer Blick. Oder anders zusammengefasst: „Je besser die Welt, desto ungerechter erscheint sie“ (S. 41). Er bezeichnet dies als großes Moralparadox der Gegenwart. Es verlange uns ab, die Gleichzeitigkeit von Wahrheitsgemäßem aushalten zu können; für Hübl eine zentrale Herausforderung unserer Zeit, um dem „Wettrüsten in moralischer Reinheit“ (S. 51) vorzubeugen.
Interessant wird es bei Hübls Verweis auf die Untersuchungen von Bradley Campbell und Jason Manning, die drei Moralkulturen bei Menschen unterscheiden: Die Ehrenkultur stellt die Frage um die Reputation ins Zentrum. Wann werde ich beleidigt und wie reagiere ich darauf? Die Tugenden Stärke und Tapferkeit sind leitende Achsen im handelnden Selbstverständnis, die eng an tribalistisches Denken geknüpft sind. Die Würdekultur hingegen richtet das Selbstverständnis nach innen und hebt den unantastbaren Wert des Menschen an sich hervor, den ich mit innerer Stärke und Resilienz für die eigene Autonomie und Selbstbestimmung kultiviere. Dies ist wiederum tendenziell mit Leistungsstreben verbunden. Leistung haftet jedoch der Verdacht an, die Quelle für Ungleichheit statt für Aufstieg und Erfolg zu sein (S. 98). Die dritte und in sich widersprüchliche Moralkultur ist gemeinhin als „woke“ bekannt und bespielt sich am liebsten selbst. Angehörige dieser Gruppe sind hypersensibilisiert für angebliche Ungerechtigkeiten und deshalb unablässig mit Fehlermanagement vor allem aber bei anderen beschäftigt. Man selbst hat längst die höchste moralische Stufe jenseits einer Heteronormativität erreicht. Oder anders zusammengefasst: „Wer zuerst Schmerz sagt, gewinnt.“ (S. 243). Obwohl eine feinsinnige Awareness von dieser Gruppe der Opferkultur immerzu eingefordert wird, wendet sie die Frage nach nicht erbrachter Leistung wie ein Geschoss gegen einen selbst und sogleich in einen strafrechtlichen -ismus (S. 177). Denn wer zuerst unter dem Deckmantel von Minderheitenschutz bei hausinternen Gleichstellungsbeauftragten, dem Rektorat oder den obersten Vorgesetzten in Unternehmen klagt, der verleiht seiner Empfindsamkeit mobartig auf X, formaly known as Twitter, eine Eigendynamik, die gar nicht mehr eingefangen werden kann, selbstverständlich ohne jegliche Prüfung des Befundes. Frei nach dem philosophischen Credo: Ich meine, daher weiß ich.
Hübl diskutiert profund das verschwurbelte Sprachgeturne und präpotente Gebaren dieses Teils der Bildungselite auf der Basis evidenzbasierter Erkenntnisse. Moral, so seine These, werde zunehmend durch die Eigenlogik in Social Media zur Selbstinszenierung jenseits von Leistungsmerkmalen genutzt. Mit reichlich Empörung und lauthals vorgetragenen Ich-Befindlichkeiten statt konziser Argumente wird moralisches Prestige als Kapital inflationär eingesetzt, oft ohne Rücksicht auf die Grundregeln der vernunftorientierten deliberativen Demokratie. Dies steigert sich wechselseitig im moralischen Statusspiel des Likens und Kommentierens wie eine Kaskade bis hin zum Statuskampf. Und genau das spiegeln die kleinen und großen Eskalationen der moralischen Selbstvermarktung wieder, die wir alle im Alltag, Beruf oder im Freundeskreis beobachten. Es macht Freude zu lesen, dass sich Hübl als herausragender Denker unserer Zeit auf weitere deutschsprachige Gesellschaftsanalysten wie Jörg Scheller oder Martin Schröder in seinen komplexen Ausführungen bezieht (S. 244). Wer in ihren Kulturanalysen steckt, vermag das Große und Ganze besser zu betrachten und im eigenen Umfeld widerständig zu argumentieren, wenn wieder irgendein Loyalitätsquatsch aufgrund eines einzigen, oft herbei fabulierten Minderheitenmerkmals beim Kölsch am Abend gefordert wird. Identitätsschützende Denkfehler gepaart mit Dominanzmarkierungen, um eine brave Konformität herzustellen, haben sich längst in gebildeten Kreisen wie in den akademischen Elfenbeintürmen verselbstständigt, sodass zu hoffen bleibt, dass die von Hübl formulierten wissenschaftlichen Tatsachen als solche gelesen, verstanden und idealerweise zur Kultivierung der eigenen intellektuellen Bescheidenheit auf Resonanz treffen.
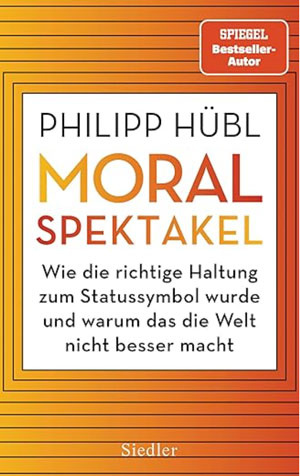 Philipp Hübl: „Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht“
Philipp Hübl: „Moralspektakel. Wie die richtige Haltung zum Statussymbol wurde und warum das die Welt nicht besser macht“
Siedler-Verlag, 26,00 Euro

