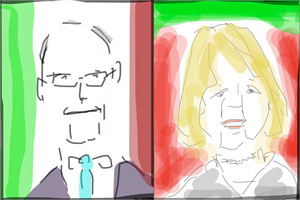Wenn eine Partei in diesem Landtagswahlkampf Glück gehabt hat, dann waren das die Grünen. Anders als der von Kleinaffären gebeutelte und moralisch abgehalfterte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers von der CDU können die Grünen nur gewinnen.
Wenn eine Partei in diesem Landtagswahlkampf Glück gehabt hat, dann waren das die Grünen. Anders als der von Kleinaffären gebeutelte und moralisch abgehalfterte Ministerpräsident Jürgen Rüttgers von der CDU können die Grünen nur gewinnen.
Egal, wie das Ergebnis ist. Sie können mit der SPD koalieren und sie haben sich unter der Vorherrschaft von Reiner Priggen eine Option auf Schwarz-Grün gesichert. Selbst wenn die Grünen in der Opposition bleiben sollten, wäre das kein Desaster. Sondern ein Gewinn.
Heute erscheint alles bei den Grünen möglich. Doch gerade wenn alles machbar ist, wird die Frage wichtig, was wäre denn das Beste.
Auf den ersten Blick schient die Frage beantwortet: ein Bündnis mit der SPD, wie gehabt, wäre das Beste.
Aber ist das wirklich so? Wenn man sich die Wahlprogramme der beiden Parteien anschaut, glaube ich das nicht. Zwar gibt es bei der Schulpolitik größere Gemeinsamkeiten, als man denkt. Aber gerade in der Energiepolitik, in der Umweltpolitik und in Wirtschaftsfragen trennen die beiden Parteien Welten.
Der Reihe nach: Die NRW-SPD verlässt sich immer noch auf den Machtkomplex der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE). Diese Gewerkschaft aber vertritt im Kern aus Sicht der Grünen unhaltbare Positionen. Die IGBCE will neue Kohlekraftwerke bauen, sie will den Industriestandort NRW bedingungslos erhalten und scheut dabei vor den Konflikten aus der Clementzeit nicht zurück. Zum Beispiel wenn es um Steinkohlesubventionen geht. Die IGBCE will diese. Jetzt. Und für immer. Die Argumente kennt jeder. Bergbau ist toll, die Subventionsmilliarden sind auch nicht verschwendet, sondern fließen in arme Regionen. Und was man sonst noch so hört.
Die Grünen können von dieser Position nichts halten. Denn sie haben anders als die SPD erkannt, dass die IGBCE nur noch die Vergangenheit im Ruhrgebiet vertritt. Die Gewerkschaft ist heute wenig mehr als das Machtgeflecht, das dem Filz im Pott früher Struktur gegeben hat. Ich sehe die Gewerkschaft wie eine Topfpflanze, die man in der Luft wild durchgeschüttelt hat. Die Wurzeln hängen noch zusammen, aber es gibt keine Erde mehr, aus der das Geflecht seine Kraft beziehen kann. Selbst bei RWE und bei E.on, den beiden wichtigsten Energiekonzernen hat die IGBCE ihre Vorherrschaft zugunsten von Verdi verloren.
Welche Ideen für die Zukunft hat die Gewerkschaft? Keine. Nur die Rezepte von früher: Subventionen für den Bergbau. Fördermilliarden für Gemeinden. Ende. Nichts, was einen neuen Anstoß geben könnte.
Da aber die SPD im Falle eines Wahlerfolges – also eines rot-grünen Regierungsbündnisses – die Unterstützung der IGBCE als Ursache für diesen Erfolg ausmachen würde, bekäme gerade dieses Erdenlose Geflecht neue Macht an Rhein und Ruhr. Nicht umsonst war Hannelore Kraft, das Kohlemädchen, erst vor ein paar Tagen wieder bei der IGBCE um sich dort feiern zu lassen. Die Grünen würden in der Partnerschaft mit der SPD gezwungen, um den Preis der Macht den Ausstieg aus dem beschlossenen Ende der Steinkohlesubventionen im Jahr 2012 mitzutragen.
Das kann für Grüne nur undenkbar sein.
Die SPD-Spitzenkandidatin Kraft hat nicht verstanden, dass die IGBCE nicht mehr das Maß aller Dinge in NRW ist. Sie hätte sich besser an Verdi gehangen. So muss sie die Grünen aus dem eigenen Lager verjagen.
Denn im Falle von rot-grün droht ein Comeback der Industriepolitik a la Wolfgang Clement: Stillstand für den Mittelstand, Rückschläge für die Umwelt und verschwendete Milliarden in hirnlosen Projekten.
Die Grünen können da nicht mitmachen, wenn sie sich nicht selbst verraten wollen.
Es bleibt die Option eines Bündnisses mit der CDU. Und gerade dies ist sehr spannend. Natürlich müsste die CDU ihre Zöpfe in der Bildungspolitik abschneiden. Aber warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich wären die konservativen Vordenker froh, wenn sie von ihrer Gesamtschulablehnung abrücken könnten. Es ist so, wie mit Hartz IV: diesen Sozialkahlschlag konnte auch nur die SPD im Bündnis mit den Köpfen der Gewerkschaften durchsetzen. Genauso können nur die Schwarzen die Gesamtschule durchboxen.
In der Energiepolitik gibt es große Chancen. CDU und Grüne wollen den Mittelstand stärken, sprich neue, alternative Energieformen unterstützen. Gleichzeitig könnten die Grünen den Einfluss der Energie-Konzerne im Bündnis mit der CDU stärker begrenzen als bei einer Regierungsbeteiligung der SPD, die mit der Energiegewerkschaft IGBCE verschwistert ist.
Vor allem aber könnte schwarz-grün ein echtes Zukunftsprojekt angehen. Und zwar den ökologischen Umbau der Kommunen, wie ihn grüne Vordenker planen.
Was sich schwammig anhört, lässt sich in wenigen Sätzen erklären. Ab 2013 werden aus den CO2-Abgabe der Energiefabriken Milliardensummen in die öffentlichen Haushalte gespült. Die Grünen wollen, dass diese Milliarden genutzt werden, um ein ökologisches Sanierungsprojekt in den NRW-Städten zu starten. Die CO2-Milliarden sollen demnach dafür eingesetzt werden, Wände zu isolieren, Fenster und Uraltheizungen auszutauschen sowie Dächer abzudichten. Damit der Energieverbrauch ganzer Regionen flächendeckend abgesenkt werden kann.
Davon würden alle profitieren. Abgerockte Viertel würden saniert. Die Städte sähen besser aus. Die Hausbesitzer und damit Wähler von CDU und Grünen bekämen etwas in die Hand. Und sogar die Mietnebenkosten könnten für die sozial schwächeren Menschen gedrosselt werden.
Damit nicht genug, das Ganze hätte auch große Beschäftigungseffekte. Tausende Tischler, Dachdecker, Fenster- und Heizungsbauer würden Arbeit auf Jahre haben.
Diese grüne Idee ist die einzige große Leitidee für ein politisches Projekt, die ich in diesem Landtagswahlkampf gehört habe.
Schwarz-Gelb verspricht ein „Weiter So“. Wobei das „Weiter So“ völlig schwammig bleibt. Was soll wie weiter gehen?
Die SPD hat gar keine Vision, außer dem „Wir machen es so, wie früher, bevor wir abgewählt wurden“ plus Gemeinschaftsschule.
Das grüne Zukunftsprojekt vom ökologischen Umbau der Kommunen könnte schwarz-grün besser umsetzen als rot-grün. Denn die IGBCE würde immer gegen die CO2-Abgabe kämpfen und eher das Geld den Konzernen auf Umwegen zurückgeben wollen, als damit irgendetwas Kreatives anzufangen.
 Ich denke, es gibt bei den Grünen eine realistische Machtbasis für ein schwarz-grünes Bündnis. Dafür hat der Grüne Vordenker Reiner Priggen gesorgt. Er hat die Kandidatenliste für den Landtag weitgehend bestimmt. Auf der Priggen-Liste sitzen genügend Leute, die schwarz-grüne Koalitionen in den Kommunen erlebt, gefördert und durchgestanden haben. Auch in der gut 14 Männer und Frauen starken Verhandlungskommission, die ab Montag bereit steht, neue Koalitionen zu verhandeln, sitzen satt über die Hälfte Menschen, die schwarz-grün gut finden. Selbst bei angeblichen Ablehnern eines CDU-Bündnisses, wie Daniela Schneckenburger aus Dortmund, kann man sich sicher sein, dass sie für schwarz-grün votieren würde. Die alten Fragmentierung in Linke und Realos gibt es sowieso in dieser Frage nicht. Zu oft haben gerade linke Grüne in den Kommunen erlebt, wie schwierig es ist, mit SPD-Genossen zu leben. Sie setzen lieber auf stabile Verhältnisse mit CDU-Leuten.
Ich denke, es gibt bei den Grünen eine realistische Machtbasis für ein schwarz-grünes Bündnis. Dafür hat der Grüne Vordenker Reiner Priggen gesorgt. Er hat die Kandidatenliste für den Landtag weitgehend bestimmt. Auf der Priggen-Liste sitzen genügend Leute, die schwarz-grüne Koalitionen in den Kommunen erlebt, gefördert und durchgestanden haben. Auch in der gut 14 Männer und Frauen starken Verhandlungskommission, die ab Montag bereit steht, neue Koalitionen zu verhandeln, sitzen satt über die Hälfte Menschen, die schwarz-grün gut finden. Selbst bei angeblichen Ablehnern eines CDU-Bündnisses, wie Daniela Schneckenburger aus Dortmund, kann man sich sicher sein, dass sie für schwarz-grün votieren würde. Die alten Fragmentierung in Linke und Realos gibt es sowieso in dieser Frage nicht. Zu oft haben gerade linke Grüne in den Kommunen erlebt, wie schwierig es ist, mit SPD-Genossen zu leben. Sie setzen lieber auf stabile Verhältnisse mit CDU-Leuten.
Auch in der Umweltpolitik gibt es keine unüberbrückbaren Gegensätze. Sowohl Grüne als auch CDU-Politiker wollen die Schöpfung erhalten und sind bereit neue Wege zu gehen. Wie etwa der schwarze Bundesumweltminister Norbert Röttgen beweist. Zumindest hat sich Röttgen nicht wie Sigmar Gabriel (SPD) in NRW für einen Erhalt der Kohlekraftwerke stark gemacht.
Bundespolitisch macht schwarz-grün Sinn. Die Grünen kämen aus der babylonischen Gefangenschaft der SPD heraus. Nicht nur die Genossen hätten dann mehr als eine Regierungsoption.
Vielleicht ist es die Angst vor der Realität dieser Bündnisoption, die Leute wie Jürgen Trittin dazu antreibt, über den Spiegel schon vor den Wahlen den umstrittenen Bau des E.on-Kohlekraftwerkes in Datteln zu einem neuen Garzweiler hochzujazzen. Es heißt, an Datteln werde sich das Schicksal eines neuen Bündnisses mit den Grünen entscheiden.
Ich glaube das nicht. Im Gegenteil. Datteln ist ein juristisches Problem. Ob das Kraftwerk fertig gestellt wird oder nicht, entscheiden Gerichte. Die Planer von E.on haben im Vertrauen auf die staatliche Macht Mist gemacht. Diese Suppe muss von den Verursachern ausgelöffelt werden. Das kann schwarz-grünen Koalitionären egal sein.
Im Gegenteil. Schwarz-grün könnte im Politikfeld der Kohlekraft sogar noch was Gutes erreichen. Mehr jedenfalls als mit den SPD-Genossen. Denn derzeit werden Pläne erarbeitet, nach denen alle Altstandorte von Kohlekraftwerken mit neuen Kohlekraftwerken bebaut werden dürfen. Die Rede ist von rund 50 Standorten, die so baufähig für Meiler wie Datteln werden könnten. Die Grünen könnten hier in den Koalitionsverhandlungen die Zahl dieser Standorte drastisch verringern – zumal im Genehmigungsverfahren bis jetzt nicht mal Umweltverträglichkeitsprüfungen vorgenommen worden sind.
Und ja. Schwarz-grün in NRW könnte sich auf Bundesebene auch erfolgreich für die Umsetzung des rot-grünen Atomausstieges einsetzen. Auch das kein Fehler.
Als dritte realistische Option nach den Landtagswahlen bleibt den Grünen die Opposition. Auch diese Möglichkeit muss keinen schocken. Denn in der Opposition haben die Grünen jetzt wieder Ideen für die Zukunft entwickelt – siehe oben. Sie haben sich stärken können und sind auf dem Weg zu einer Volkspartei. Sollte die SPD in eine große Koalition eintreten, verfällt das Land in eine Stagnation, wie die Sowjetunion zur Breschnjew-Zeit. Die SPD würde sich endgültig überflüssig machen. Und in fünf Jahren kämen die Grünen mit Glanz an die Macht. Das einzige was dagegen spricht: für Machtakrobaten wie Priggen käme der Aufstieg zu spät. Sie könnten nicht mehr Minister werden. Deswegen sind wohl eher die ersten beiden Optionen wahrscheinlicher.
Am Schluss phantasieren immer noch irgendwelche Politbeobachter von rot-rot-grün. Doch das ist so irre, das macht hoffentlich keiner – hoffe zumindest ich.
Bei den Linken haben die extremistischen Strömungen von AKL (Trotzkisten und Kommunisten) und der SL (Gewerkschaftsromantiker) die Macht – dort sind Realisten, die die Linke in der Ex-DDR regierungsfähig machen, völlig marginalisiert. Mit AKL-isten und SL-lern kann man keine Politik für 17 Mio. Menschen machen. Das ist unverantwortlich. Die Zukunft des Landes darf nicht von zufälligen Bündnissen irrer Trotzkisten mit autoritären Kommunisten abhängen. Und es ist utopisch, daran zu glauben, die AKL in der Mehrheit könnte eingedämmt werden, wie die Verrückten im Osten. Warum ist Sarah Wagenknecht denn nach NRW gekommen? Weil sie sich in Berlin durchsetzen konnte? Oder weil sie eine neue Machtbasis in NRW gesucht hat?
Sollten die Linken in die NRW-Regierung rücken, wäre Wagenknecht mit an der Macht.