

Diese Reihe – die letzte Folge ist hier – beschäftigt sich mit den Entwicklungen in der hiesigen Soziokultur. Diesmal geht es im Gespräch mit Kornelia Vossebein, seit einem guten halben Jahr neue Geschäftsführerin der Zeche Carl, auch, aber nicht nur, um mögliche Neubeginne und die Balance zwischen Tradition und Modernisierung.
Jens Kobler ? (auch Fotos): Zur Einführung vielleicht ein paar kurze Worte zur Geschichte der Zeche Carl aber auch die Frage, wie Du hier die Veränderungen erlebt hast: Was ist neu hier seit einem halben Jahr, was ist geblieben und wie bist du hierher gekommen?
Kornelia Vossebein !: Die Zeche ist ja relativ früh entstanden, als Altenessener Bürgerinnen und Bürger sowie die evangelische Kirche auch über Aufrufe in der Zeitung das Gebäude für sich umgenutzt und auch umgebaut haben. Carl ist insofern ein absoluter Prototyp für Orte wie Zeche Zollverein etc.: „Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ gab es hier mit als erstes. 1979 wurde der betreibende Verein gegründet, und bald wurde man durch Veranstaltungen und politische und Stadtteilarbeit überregional bekannt.
Ich selbst komme ursprünglich aus Bielefeld und habe dann erst das Ende des Prozesses der Umwandlung in eine gemeinnützige GmbH im letzten Jahr mitbekommen. Zuvor gab es einen Verein mit einem geschäftsführenden Vorstand. Der Betriebskostenzuschuss von der Stadt und die Aufgabe, ein Soziokulturelles Zentrum zu betreiben, das auch niedrig schwellige Angebote und Stadtteilarbeit macht, sind geblieben.
?: Es gab ja offensichtlich auch Vorbehalte gegenüber der Geschäftsführung des Vereins, viele Verhandlungen und schließlich eine Ausschreibung, aufgrund derer du jetzt hier bist.
!: Die vollzogene Insolvenz hatte bedeutet, dass die 22 Angestellten in eine Transfergesellschaft gekommen sind. Die Stadt hat also einen irren Aufwand betrieben, um Carl zu erhalten, wozu auch gehörte, dass sich um Weiterbildung für ehemalige Mitarbeiter gekümmert wurde, während klar gemacht wurde, dass es hier weiter gehen sollte, aber mit einer anderen Betreiberstruktur, die mehr Transparenz gewährleisten und eine weitere Insolvenz für die Zukunft verhindern sollte. Die Reinigungskräfte, der Haustechniker, einige andere und viele Fremdveranstalter sind geblieben, aber die ehemalige Personaldecke allein hatte damals den Betriebskostenzuschuss schon überstiegen – das war einer der Sargnägel des Vereins. Schon in der Interimszeit wurde also geprüft, welche Struktur hier funktionieren würde, und dann gab es im April eine Ausschreibung über die Geschäftsführung. Ich kam aus dem vollen Lauf aus meiner neunjährigen Tätigkeit für den Bunker Ulmenwall in Bielefeld und wurde irgendwann angesprochen vom Leiter der LAG Soziokultur, dass sich da auf Carl etwas tut. Im Mai kam dann die Berufung, jetzt bin ich hier.
?: Kamen dann direkt die Technopartyveranstalter, die hier die Tür eingerannt haben? Oder wie gestaltete sich die erste Zeit?
!: Die sogenannte Interimsphase, also die Zeit vom Konkurs bis zum Neustart war ziemlich lang. Es gab zehn Monate lang ein leitungsloses Haus, das aber aus bestimmten Gründen nie ganz geschlossen sein sollte. Man hat also Hilfskonstrukte gefunden, damit zumindest die Kurse weiterlaufen und die Fremdveranstalter ihre Partys machen konnten. Für so ein Zentrum ist das aber natürlich ein Schock! Und auch ein ziemlich schweres Erbe, denn du hast hier die Zeit vor der Insolvenz, aus der so diese Schwingung „Hier sieht’s nicht gut aus!“ immer noch herüberschwappte und eine – sagen wir einmal – negative Presse, die sicherlich einen Imageschaden bewirkt hat. Und es gab die Interimszeit mit Leuten, die nur das Organisatorische gewährleisten sollten. Aber letztlich gab es in dieser langen Interimszeit keine handelnden Personen und keine echten Handlungsmöglichkeiten. Egal wo man da eine Schuld suchen mag, alleine dadurch haben dieser Schock und diese Verunsicherung stark nachgewirkt. Bei Partyveranstaltungen waren dann nicht mehr 1000 Leute da, sondern nur noch 500. Und selbstverständlich ist Carl in dieser Zeit auf der Karte vieler Veranstaltungsagenturen ganz einfach verschwunden. Der Neustart wiederum bedeutete also nicht, dass man im August die Türen wieder aufschließt und alles ist gut. Sondern man muss viele vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen, neue Konzepte entwickeln, aber auch herausfiltern, was gut war an Carl vorher. Denn inhaltlich ist Carl ja bestimmt nicht gescheitert. Also gab es viele, viele Gespräche, auch Beschwerden, wo viele Emotionen kanalisiert werden mussten.
 ?: Das ist ja auch recht typisch, fast wie bei einem Systemwechsel, so á la „So schlimm können die vorher gar nicht gewesen sein – die waren doch immer nett zu mir“ und „Die Neue ist aber fremd!“. Sind denn auch Gruppen abgesprungen aus einer Art Solidarität mit dem Verein oder den Angestellten und haben dem Stadtteil die kalte Schulter gezeigt? Und wenn hier jetzt nicht gerade eine ganz andere Politik betrieben wird, dann müsste es sich doch hoffentlich irgendwann einmal legen mit dem Fremdeln, oder? Vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt mal auf das aktuelle Programm einzugehen.
?: Das ist ja auch recht typisch, fast wie bei einem Systemwechsel, so á la „So schlimm können die vorher gar nicht gewesen sein – die waren doch immer nett zu mir“ und „Die Neue ist aber fremd!“. Sind denn auch Gruppen abgesprungen aus einer Art Solidarität mit dem Verein oder den Angestellten und haben dem Stadtteil die kalte Schulter gezeigt? Und wenn hier jetzt nicht gerade eine ganz andere Politik betrieben wird, dann müsste es sich doch hoffentlich irgendwann einmal legen mit dem Fremdeln, oder? Vielleicht eine gute Gelegenheit, jetzt mal auf das aktuelle Programm einzugehen.
!: Ich denke, wir haben viele Partner, auch politische Gruppen wieder gewonnen. Klar ist aber auch, dass Carl z.B. kein parteienspezifisches Ding sein soll. Carl soll ein Diskussionsort sein, an dem sich alle möglichen Fraktionen ansiedeln. An einem Wochenende im Herbst, als ich hier noch recht neu war, gab es eine Vermietung an die Junge Union, und am nächsten Tag waren die Linken da – und so will ich das haben.
?: Kurzer Einwurf: Nach einer Runde im FZW sagte ich noch letztens: Wie kann man sich überhaupt nur auf eine Partei verlassen, geschweige denn auf die SPD unter Langemeyer? Da dreht sich ganz schnell das Blatt, und plötzlich hat man SPD und CDU gegen sich, wenn man nicht aufpasst. Aber gut.
!: In Bezug auf andere Bereiche: Das Kursprogramm wird wieder ausgeweitet, von Selbstverteidigung für Kinder bis zu Yoga für ältere Frauen. Allgemein sind viele geblieben, und manche schnuppern jetzt wieder. Und es ist ja auch wichtig, dass Carl ein Ort ist, an dem man sich wohlfühlen kann. Ich bin eher eine, der vieles nicht schnell genug gehen kann, aber unser Wirt hier sagte letztens: „Als wir hier angefangen haben, war Carl tot.“ Und er hat recht, ich habe das immer „die Glocke der Depression“ genannt. Es muss noch viel mehr Leben kommen, das ist klar, aber ich habe den Eindruck, Carl kommt wieder. Und das muss mit den Menschen vor Ort passieren – was ein anderer Kulturbegriff als der einer Philharmonie z.B. ist, der es ziemlich egal ist, in welchem Stadtteil sie steht.
?: Ich habe so etwas letztens mal „Drive-In-Mentalität“ genannt: Hinfahren, Einparken, Konsumieren, Ausparken, Wegfahren.
 !: Ja, das ist hier schon eine andere Konzeption. Natürlich kommt so etwas hier zu Highlight-Konzerten auch vor, und Carl ist ja nicht für seine Stadtteilarbeit überregional bekannt geworden. Auch diese Konzerte will man ja, aber es geht großteils eher um die Menschen, die etwas von Carl persönlich wollen, sozusagen. Aber wo wir dabei sind: Früher gab es zwei Stellen für Konzerte und eine halbe für Kabarett. Ich arbeite mehr mit Veranstaltern oder Kuratoren und buche zum Teil auch selbst. Geschäftsführung war auch in Bielefeld für mich nicht nur Buchhaltung, und das ist auch wichtig für meine persönliche Motivation. Ich mache das ja nicht, weil ich gerne vor Statistiken sitze oder Bilanzen mache. Es geht um ein Programm,…
!: Ja, das ist hier schon eine andere Konzeption. Natürlich kommt so etwas hier zu Highlight-Konzerten auch vor, und Carl ist ja nicht für seine Stadtteilarbeit überregional bekannt geworden. Auch diese Konzerte will man ja, aber es geht großteils eher um die Menschen, die etwas von Carl persönlich wollen, sozusagen. Aber wo wir dabei sind: Früher gab es zwei Stellen für Konzerte und eine halbe für Kabarett. Ich arbeite mehr mit Veranstaltern oder Kuratoren und buche zum Teil auch selbst. Geschäftsführung war auch in Bielefeld für mich nicht nur Buchhaltung, und das ist auch wichtig für meine persönliche Motivation. Ich mache das ja nicht, weil ich gerne vor Statistiken sitze oder Bilanzen mache. Es geht um ein Programm,…
?: ,… und um einen Charakter wohl. Von typischer „Ältere Jungs“-Warte wurde mir oft gesagt: „Die bei Carl machen nicht genug Punk und Heavy Metal. Die Leute sind jetzt alle weg. Wenn sie die nicht zurückholen, können die das gleich vergessen.“ Was natürlich eine etwas eingeschränkte, leicht machohafte und vielleicht sogar konservativ-reaktionäre Haltung sein kann.
!: Mir geht es schon darum, auch im musikalischen Bereich eine gewisse Vielfalt hier wiederzuhaben. Die ehemalige Entwicklung zum Punk-, Metal-, Gothic-Schuppen war ja historisch gesehen relativ neu. Nichts gegen diese, aber das ist nur eine Programmfarbe von vielen. Klar ist auch, dass man einen langen Atem braucht, um eine neue Stilistik einzuführen.
?: Es könnte ja womöglich ein Gewinn sein, sich neu auf Carl einzulassen, weil ja Veränderungen nicht immer schlecht sein müssen…
!: ,… und mit den Konsequenzen muss man dann leben. Wenn also Leute sagen, dass hier nur noch drei, vier Mal im Jahr was für sie ist und sie deshalb nicht mehr kommen, dann muss ich sagen: „Schade, dann habt Ihr Carl nicht verstanden.“ Andersherum ist es fast wichtiger: Diejenigen, die erst einmal merken müssen, dass hier nicht nur Punk und Heavy Metal ist. Die müssen wir gewinnen. Viele sagen auch, dass man hier jetzt wieder hingehen kann, weil es sauberer ist, die Gastronomie besser aussieht, usw. Das Team hat das Haus quasi lieb. Wir schätzen das Equipment, lassen Fremdplakatierungen halt nur bedingt zu und halten alles in Ordnung. Das ist eben nicht spießig, das ist eher modern und zukunftsträchtig. In einem Haus, das nur eine Stilistik fährt, ist es natürlich einfacher, ein Image zu bilden. Carl soll aber vielfältig sein, aufgestellt sein für Menschen von Kindern bis zu Senioren. Das Seniorencafé boomt schon wieder. Und es ist mir auch wichtig, dass sich hier Menschen ausprobieren können, von Selbsthilfegruppen bis hin zu Kreativkursen. Idealiter hätte ich gerne eine Kreativszene, die sich hier wieder neu und anders ansiedelt.
?: Klingt wie „bunt, aber nicht autonom“. Das führt ja auch zu Problemen wie z.B. einmal im Druckluft zwischen HipHop und Feministinnen und Schwulen oder zwischen Migranten und Feministinnen oder hedonistisch orientierten und Konsumverzicht übenden. Gibt es hier auch solche Reibungsflächen? Das ist ja auch eine Frage, wie viel Radikalität man zulässt.
!: Wir hatten mal Belegungen wie die Popolskis vor dem Glamourdome, und da war ich eher positiv überrascht, wie eher bürgerliches mit offensiv schwulem Publikum klargekommen ist. Und bald haben wir auch wieder drinnen ein Punkkonzert und draußen etwas eher Gutbürgerliches. Mal gucken, wie das dann funktioniert.
?: Das soll ja nun auch sicher die Funktion so eines Stadtteilzentrums sein, dass eben nicht Gettoisierung und Separatismus gefördert werden.
!: Wobei ich natürlich da schon Rücksichten nehme. Außerhalb eines sexistischen und rassistischen Bereichs muss Koexistenz aber ganz klar möglich sein, idealiter sogar Kooperation. Beim Fest am 1. Mai wird man das auch in diesem Jahr wieder sehen: Ein bunt gemischtes Publikum, diesmal aber auch mit zwei, drei Highlight-Konzerten.
?: Überhaupt war Carl ja schon immer viel mehr als die großen Säle. Wie steht es im Moment eigentlich um die Nachbarhäuser hier auf dem Gelände?
!: Das Ensemble Zeche Carl. Wie ich finde, eines der wärmsten und schönsten Zechengeländen. Natürlich ist das Casino unsere Hauptaufgabe, das ist klar. Der Malakow-Turm steht still und leer und ist baulich wieder bei der Immobilienwirtschaft. Was da umgebaut werden muss, das läuft gerade. Das Maschinenhaus war und ist an den Carl Stipendium Maschinenhaus Essen e.V. verpachtet, wo ab und an Vermietungen, Ausstellungen, Theaterstücke, Proben stattfinden. Im Badehaus sitzt nach wie vor der Offene Kanal, leider derzeit ohne Senderechte, und die Neue Essener Welle. Im ehemaligen Pförtnerhaus ist der Förderturm e.V. und macht Kinderbetreuung. Und so muss man das hier auch betrachten: Mal angenommen, in das Maschinenhaus käme ein Matratzenlager und ins Badehaus ein REWE: Das machte überhaupt keinen Sinn. Es muss sich hier inhaltlich gut ergänzen, und Synergien müssen sich ergeben.
?: Abschließend: Das Arbeiten in einem Stadtteil einer großen Stadt innerhalb einer sehr großen Städteballung ist sicher ein anderes als in Bielefeld. Welche Unterschiede sind dir da aufgefallen?
!: Ich kannte vorher schon z.B. den Bahnhof Langendreer oder auch das zakk sehr gut. Und in Essen gibt es ja ansonsten nur noch das Grend, aber dem gegenüber arbeitet Carl schon ganz anders. Man will also keine Konkurrenz sein zu anderen Zentren, sondern arbeitet eher an einem Profil, das auch eine Ergänzung zu anderen Angeboten bietet. In Bielefeld wiederum waren wir auch vernetzt mit Zentren wie dem domicil in Dortmund oder dem Stadtgarten in Köln. Außerdem ist Bielefeld übrigens auch in einer Haushaltssicherung. Generell sind die Vernetzungen hier natürlich anders als dort, aber bei knappem Geld muss man sich überall gleich rechtfertigen. Und dadurch dass ich nicht von hier bin, gehöre ich halt zu keiner Seilschaft und bin neutral. Da überwiegen dann die Vorteile, denke ich. All die Kontakte hier vor Ort herzustellen, das dauert schon seine Zeit. Aber so kann ich mir andererseits auch mein eigenes Bild machen.
?: Vielen Dank für den Einblick und weiterhin alles Gute!
www.zechecarl.de
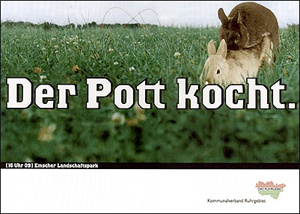 Am Dienstag hat die Hamburger Werbeagentur Springer & Jacoby Insolvenz angemeldet. Im Ruhrgebiet sorgte sie mit der RVR-Kampagne „Der Pott kocht“ für Aufsehen.
Am Dienstag hat die Hamburger Werbeagentur Springer & Jacoby Insolvenz angemeldet. Im Ruhrgebiet sorgte sie mit der RVR-Kampagne „Der Pott kocht“ für Aufsehen.













 Hier ist der dritte Teil unserer Online-Ausstellung mit Werken von
Hier ist der dritte Teil unserer Online-Ausstellung mit Werken von  Die Idee klingt gut: Die Ruhr2010 GmbH will Angebote von Vermietern sammeln, die an Unternehmen aus dem Bereich der Kreativwirtschaft vermieten wollen. Peinlich wird es, wenn ein Vermieter bei der Ruhr2010 GmbH anruft.
Die Idee klingt gut: Die Ruhr2010 GmbH will Angebote von Vermietern sammeln, die an Unternehmen aus dem Bereich der Kreativwirtschaft vermieten wollen. Peinlich wird es, wenn ein Vermieter bei der Ruhr2010 GmbH anruft. Auch medial wollten die Macher von Ruhr2010 neue Wege gehen: Mit dem 2010lab. Nach zwei Monaten ist klar: Das Lab ist ein Flop.
Auch medial wollten die Macher von Ruhr2010 neue Wege gehen: Mit dem 2010lab. Nach zwei Monaten ist klar: Das Lab ist ein Flop.
 Der Autor dieser Zeilen: ist betroffen. Denn er: hat vielleicht Übles bewirkt. Schrieb er nicht letztens
Der Autor dieser Zeilen: ist betroffen. Denn er: hat vielleicht Übles bewirkt. Schrieb er nicht letztens 