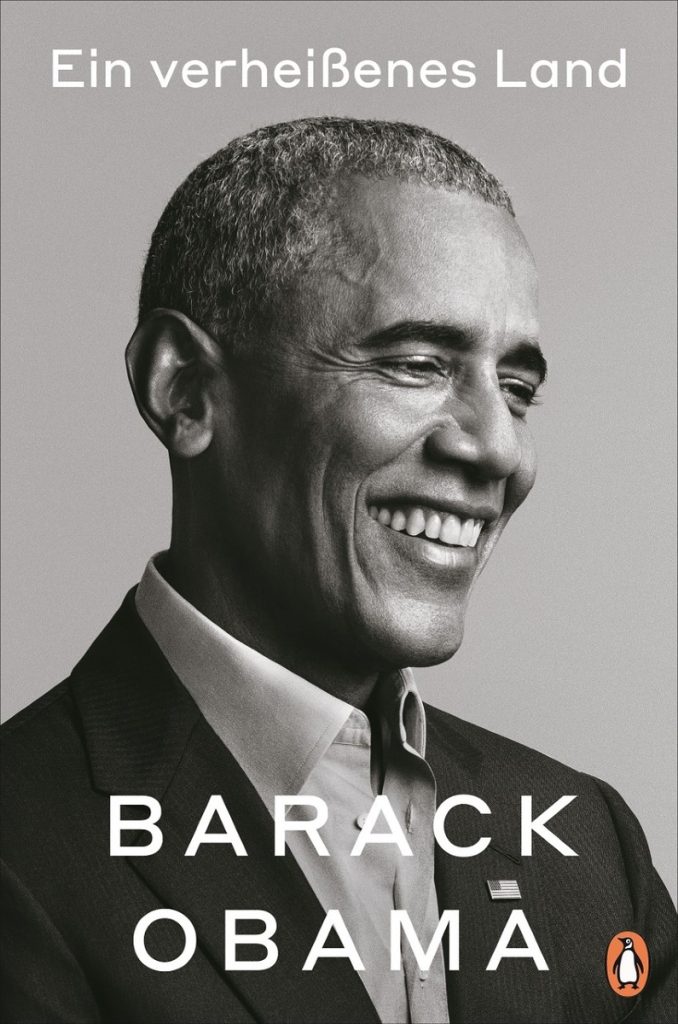Richard Holbrooke ist tot. Er starb gestern während einer Operation an seiner Halsschlagader im Alter von 69 Jahren. Barack Obama bezeichnete ihn als einen „wahren Giganten der US-Außenpolitik“, David Petraeus würdigte ihn als einen „Titanen“, Joe Biden nannte ihn den „talentiertesten Diplomaten seiner Generation“ und Hillary Clinton – vergleichsweise nüchtern – den „entschiedensten Verteidiger und treuesten Diener Amerikas“. Jetzt, nach seinem Tod, werden sich die anerkennenden Worte häufen. Dabei kann man über Holbrooke vieles sagen, nur eines nicht. Richard Holbrooke war nicht sonderlich umgänglich.
Holbrooke war nicht der Typ von Kumpel, den man ständig um sich haben möchte. Und ob er, wie Biden formulierte, ein talentierter Diplomat war, ist letztlich eine Definitionsfrage. Obama hatte Holbrooke, dessen Beauftragter für Afghanistan und Pakistan er war, engmaschig kontrolliert, da Holbrooke ständig mit dem außenpolitischen Apparat im Weißen Haus aneinander geraten ist. Petraeus waren Holbrookes Bemühungen um eine Einbindung der Taliban in einen Aussöhnungsprozess ohnehin äußerst suspekt. Holbrookes tiefe Verachtung für Karzai war allgemein bekannt.
Einzig Hillary Clinton stand in letzter Zeit voll auf seiner Seite; Holbrooke war ein enger persönlicher Freund der Clintons. Als er letzten Freitag im Büro der Außenministerin Bericht erstattete, platzte ihm die Halsschlagader. Holbrooke soll seine Beschwerden zunächst heruntergespielt haben, bevor er auf dem Weg zum Arzt zusammengebrochen ist. Der Riss an der Aorta wurde letzte Nacht 20 Stunden lang operiert. Richard Charles Albert Holbrooke, so sein vollständiger Name, überlebte die Operation nicht.
In den Vereinigten Staaten ist es üblich, den Vornamen Richard auf die Kurzform „Dick“ zu reduzieren. Holbrooke mochte das nicht. Weniger wegen der obszönen Verwendung des Wortes für das männliche Geschlechtsteil, was ja dann alle Richards stören müsste. Vielmehr deshalb, weil unter einem „Dick“ ebenfalls ein unangenehmer Mensch verstanden wird. Man denke an den deutschen „Dickkopf“. Die „Naturgewalt der US-Diplomatie“ wollte nicht mit „Dick“ angesprochen werden; dabei konnte Holbrooke verdammt unangenehm werden.
Unvergessen ist Holbrookes Rolle beim Zustandekommen des Dayton-Abkommens, das die Gräuel des Bosnienkrieges beendete. „Diese Soldaten“, stellte Holbrooke US-Militärs in Belgrad Slobodan Milošević vor, „befehligen die amerikanischen Luftstreitkräfte, die bereit stehen, Sie zu bombardieren, wenn wir nicht zu einer Einigung gelangen“. In Dayton (Ohio) pflegte er den serbischen Diktator anzuschreien und übte auch auf die anderen Konfliktparteien einen solch enormen Druck aus, dass ihnen ein Friedensabkommen als das kleinere Übel erscheinen musste – kleiner jedenfalls, als länger ihn ertragen zu müssen.
Mit Richard Holbrooke verlieren die USA einen einmaligen Außenpolitiker – einmalig, aber doch ein Mann der „alten Schule“, insofern, als dass sein Denken und Handeln vornehmlich von der Zeit geprägt war, in der die Vereinigten Staaten als einzig verbliebene Supermacht meinten, der Welt ihren Willen aufdrücken zu können. Es zählt zu den bleibenden Verdiensten Holbrookes, nach dem dramatischen Versagen Europas das Gemetzel in Bosnien beendet und damit seinen Teil dazu beigetragen zu haben, dass der Balkan (jedenfalls bislang noch) nicht in einem mörderischen Chaos versunken ist. Jahrzehntelang war Holbrooke für den Auswärtigen Dienst tätig, u.a. war er 1993 für neun Monate Botschafter der USA in Bonn.
Holbrookes Mutter Trudi Moos war 1933 nach der Machtergreifung der Nazis mit ihrer Familie von Hamburg nach Buenos Aires emigriert. 1939 wanderte sie dann in die USA ein, wo sie Holbrookes Vater kennenlernte, der Ende der 30er Jahre aus Weißrussland in die USA ausgewandert war. Holbrooke hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Söhne.